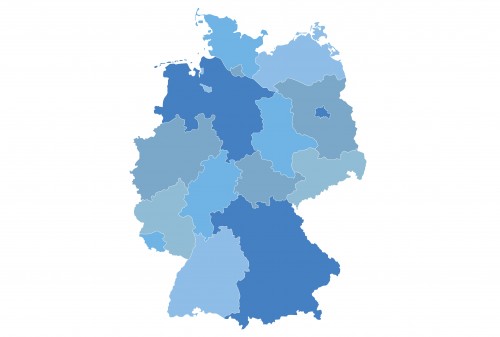Im Jahr 2016 wurden 19,5 Millionen Patientinnen und Patienten stationär im Krankenhaus behandelt. Das waren 277 400 Behandlungsfälle oder 1,4 % mehr als im Jahr zuvor. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, dauerte der Aufenthalt im Krankenhaus wie im Vorjahr durchschnittlich 7,3 Tage.
In 1 948 Krankenhäusern Deutschlands standen für die stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten insgesamt 498 700 Betten zur Verfügung. Annähernd jedes zweite Krankenhausbett (47,8 %) stand in einem Krankenhaus eines öffentlichen Trägers, jedes dritte Bett (33,5 %) befand sich in einem freigemeinnützigen Haus. Der Anteil der Krankenhausbetten in Einrichtungen privater Träger betrug 18,7 %.
Die durchschnittliche Bettenauslastung lag bei 77,8 %. Die Betten in öffentlichen Krankenhäusern waren zu 79,9 % ausgelastet, in freigemeinnützigen Häusern zu 76,6 % und in privaten Häusern zu 74,9 %.
Rund 894 500 Vollkräfte – das ist die Anzahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten – versorgten 2016 die Krankenhauspatientinnen und -patienten. Rund 158 000 Vollkräfte gehörten zum ärztlichen Dienst und 736 500 zum nichtärztlichen Dienst, darunter allein 325 200 Vollkräfte im Pflegedienst. Die Zahl der Vollkräfte nahm im Vergleich zum Vorjahr im ärztlichen Dienst um 3 600 (+ 2,3 %) zu, im nichtärztlichen Dienst um 22 800 (+ 3,2 %). Die Zahl der Pflegevollkräfte stieg um 4 300 (+ 1,3 %).
Knapp zwei Millionen Patientinnen und Patienten nahmen im Jahr 2016 eine stationäre Behandlung in einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung in Anspruch. Das waren 13 300 Behandlungsfälle mehr als im Vorjahr (+ 0,7 %).
In 1 148 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen standen knapp 164 900 Betten zur Verfügung. Anders als bei den Krankenhäusern sind bei den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen private Träger die größten Anbieter: Hier standen fast zwei Drittel aller Betten (65,7 %). Einrichtungen öffentlicher Träger verfügten über 18,5 % der Betten. Den geringsten Anteil hatten freigemeinnützige Einrichtungen mit 15,8 % des Bettenangebots.
Die durchschnittliche Bettenauslastung lag bei 83,2 %. Öffentliche Einrichtungen erreichten eine Bettenauslastung von 91,3 % und freigemeinnützige Einrichtungen von 84,8 %. Die Betten privater Einrichtungen waren mit 80,6 % am geringsten ausgelastet.
Rund 8 700 Vollkräfte im ärztlichen Dienst und 83 900 Vollkräfte im nichtärztlichen Dienst – darunter 21 300 Pflegevollkräfte – versorgten 2016 die vollstationären Patientinnen und Patienten in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen.
Die vollständige Pressemitteilung (inklusive PDF-Version) mit Tabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Presse.html zu finden.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Gustav-Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden, www.destatis.de, 14.08.2017