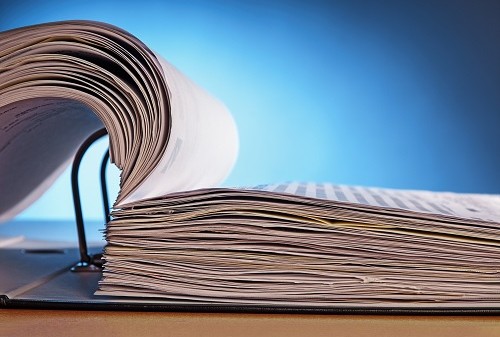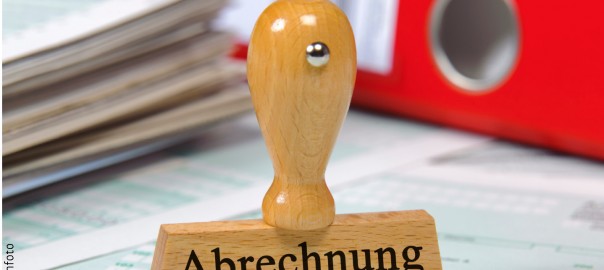Die ABDA begrüßt als Spitzenorganisation der deutschen Apotheker die Pläne des Bundesgesundheitsministers Jens Spahn, ein E-Rezept ab 2020 einzuführen. „Wir haben dem Bundesgesundheitsminister bereits im Sommer ein Konzept unterbreitet, wie wir uns die Einführung einer elektronischen Verordnung vorstellen. Wir wollen hier federführend unsere Expertise einbringen“, sagt Friedemann Schmidt, Präsident der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. „Wichtig ist uns dabei, dass der Patient der Herr seiner Daten bleibt und weiterhin die freie Apothekerwahl hat. Zugleich müssen die Prozesse zwischen Ärzten, Apothekern und Krankenkassen auf Basis der Telematik-Infrastruktur eindeutig festgelegt werden.“
Die Apothekerschaft stellt einige Forderungen an E-Rezepte. Schmidt: „Das E-Rezept darf kein Handelsobjekt werden, deshalb muss zum Beispiel das Makeln damit verboten werden. Außerdem muss auch in der digitalen Welt das Zuweisungsverbot Bestand haben. Die Entscheidungshoheit des Patienten, welche Apotheke sein Rezept beliefern soll und wo er sich beraten lassen will, muss erhalten bleiben.“
Digitalisierte Arbeitsabläufe sind in den Apotheken längst selbstverständlich. Schmidt: „Sobald Apotheker das Papierrezept in Händen halten, sind alle danach folgenden Prozesse wie zum Beispiel die Auswahl des passenden Rabattarzneimittels, die Warenbestellung oder die Abrechnung komplett digitalisiert. Für uns ist das E-Rezept nur die letzte digitale Meile, die noch zu überbrücken ist.“
Quelle: ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., Unter den Linden 19 – 23, 10117 Berlin, www.abda.de, 13.11.2018