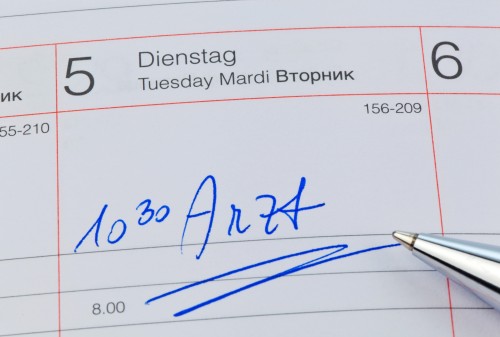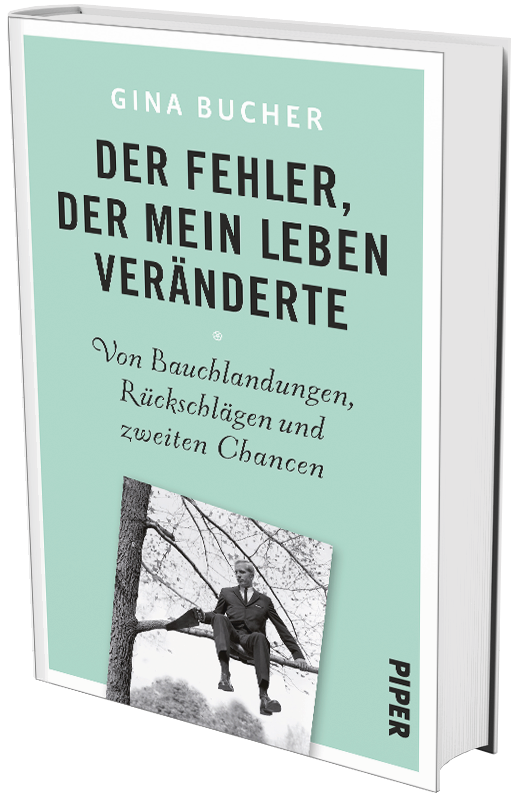Junge Ärzte haben in der Regel kein großes Interesse an berufspolitischem Engagement, sondern eher an einer guten „Work-Life-Balance“. Heißt es zumindest. Vielleicht mag an diesem Vorurteil etwas dran sein, doch es trifft längst nicht auf alle zu. Der änd spricht mit Nachwuchsärzten, für die es selbstverständlich ist, in einem Verband oder einer Organisation berufspolitisch aktiv zu sein. Heute im Interview: Dr. Benedikt Johannes Braun, stellvertretender Leiter des Themen-Referats Nachwuchsförderung im Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC).
|
Ärztenachrichtendienst: Herr Dr. Braun, wie weit ist Ihre berufliche Laufbahn fortgeschritten – sind Sie noch in der Ausbildung?
Dr. Braun: Glücklicherweise konnte ich meine Facharztprüfung gerade vor zwei Wochen zeitgerecht und erfolgreich ablegen. Ich arbeite in der Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie der Universitätskliniken des Saarlandes in Homburg. Eine spannende und herausfordernde Tätigkeit – in einem gut aufgestellten Team.
änd Wann fiel bei Ihnen denn die Entscheidung, Chirurg zu werden. Schon für früh im Studium?
BB Ich muss zugeben, dass ich da ein wenig familiär geprägt bin: Mein Vater ist auch Unfallchirurg. Das hat aber interessanterweise gar nicht primär dazu geführt, dass ich dann in diesem Bereich landete. Ich war im Studium auch offen für andere Zweige der Medizin, habe zum Beispiel meine Promotion in der Neuro-Anatomie gemacht. Meine damalige Freundin – und jetzige Frau – wollte eigentlich immer Unfallchirurgin werden, sie hat mich dann ein wenig angesteckt und eine Begegnung kurz vor dem PJ mit meinem jetzigen Chef hat mein Schicksal besiegelt. Witzigerweise ist sie jetzt Frauenärztin und nur ich bin in der Unfallchirurgie gelandet.
änd Was hat Sie letztendlich daran fasziniert?
BB Ich denke, dass es eine besondere Form der Herausforderung ist, welche die Chirurgie und die Unfallchirurgie ganz speziell ausmacht. In anderen Bereichen ist die Diagnose oft das Schwierige. Bei uns ist die Aufgabenstellung oft eindeutig: Es kommt zum Beispiel ein verunfallter Patienten mit einem bestimmten Bruch, der gerichtet und chirurgisch versorgt werden muss – klare Aufgabenstellung, klare Lösung. Und doch ist es eine Herausforderung zu wählen, welcher Zugangsweg, welche Fixationsmethode die optimale ist. Ein differenziertes Vorgehen ist notwendig um zu klären wie ich das zufriedenstellendste Ergebnis erreiche. Natürlich muss man auch eine gewisse Liebe zum feinmotorischen Arbeiten mitbringen.
änd Wann kamen Sie auf die Idee, sich im BDC berufspolitisch zu engagieren. Sind Sie von Kollegen „angesteckt“ worden?
BB Das hat sich eigentlich eher per Zufall ergeben. Zu Beginn meiner Karriere hatte ich da kaum Berührungspunkte. Mein Chef in der Klinik war dann aber Kongresspräsident der Fachgesellschaft DGCH, die auf der Suche nach Nachwuchssprechern war. Da habe ich mich zunächst mehr oder weniger überreden lassen – und habe erst einmal vorsichtig reingeschnuppert. Ich war dann aber schnell davon überzeugt, dass es eine sinnvolle Tätigkeit ist. Das Engagement im BDC war dann gleich zu Beginn etwas bewusster gewählt und hat sich letztlich aus Gesprächen mit dem Vizepräsidenten dort ergeben, der ebenfalls für die Nachwuchsarbeit brennt. Es gibt so viele Kollegen, die sich über die Rahmenbedingungen beschweren und in irgendwelchen Chirurgieforen im Internet ständig meckern. Ich finde es da besser, gemeinsam mit engagierten Kollegen nach Lösungen zu suchen, konstruktive Vorschläge zu machen und Änderungen auch öffentlich einzufordern. Diese Einstellung treibt mich in der Berufspolitik voran.
änd Warum sehen das aber immer nur eine Handvoll junger Kollegen so?
BB Eine gute Frage. Mich wundert das zum Teil auch. Vielleicht beruht die Zurückhaltung ein wenig darauf, dass es – wie gesagt – immer bequemer ist, die Zustände nur zu kritisieren. Den Hintern hochzubekommen und aktiv etwas zu unternehmen, ist schon wieder eine andere Sache. Vielleicht ist der Leidensdruck dann in manchen Bereichen doch nicht so hoch. Prinzipiell glaube ich aber auch, dass viele Kollegen falsche Vorstellungen davon haben, wie das Engagement in einem Berufsverband wie dem BDC, oder bei den Fachgesellschaften aussehen kann. Ich kann nur dazu raten, einfach einmal unverbindlich reinzuschnuppern und zum Beispiel eine Sitzung mitzumachen. Manchmal legt sich dann gedanklich ein Schalter um.
änd Allerdings braucht man auch Zeit für dieses Engagement. Haben Ihre Vorgesetzen und Kollegen in der Klinik dafür Verständnis?
BB Zum Glück habe ich hier eine komplette Abteilung, die das mitträgt und viel Verständnis hat. Ansonsten wäre das für mich auch nur schwer vorstellbar. Das Verständnis muss natürlich auch in der Familie da sein und ich schätze mich sehr glücklich eine Ehefrau zu haben, die das Ganze nicht nur toleriert, sondern aktiv unterstützt.
änd Studium und Ausbildung sind Ihnen noch frisch in Erinnerung. Wo haben Sie Missstände oder suboptimale Rahmenbedingungen für die chirurgische Tätigkeit erlebt?
BB Ich hatte das Glück, in einem der frühen Jahrgänge des Modellstudienganges in Aachen studiert zu haben, der schon sehr gute Bedingungen und eine stets motivierende Stimmung geboten hat. Da ist man prinzipiell auch gut für die Chirurgie begeistert worden. Was mich aber grundsätzlich an der Ausbildung hierzulande stört, ist die Willkür, der die Studierenden in der Chirurgie ausgesetzt sind. Kommt man im PJ an eine Klinik, ist man letztendlich der Abteilung dort „ausgeliefert“ ob die eine gute oder schlechte Lehre machen und das in einer für die spätere Berufswahl absolut prägenden Zeit. Es gibt zwar schon länger PJ-Onlineforen, in denen die Bedingungen bewertet werden können. Allerdings haben offenbar auch die schlecht abschneidenden Kliniken noch zu wenig Probleme, PJler zu finden. Das PJ ist für die Studierenden aber unwahrscheinlich prägend. Trifft man hier auf junge Assistenten, die bedingt durch arztfremde Tätigkeiten viele Überstunden machen müssen oder mit überflüssiger Bürokratie belastet werden, ist das nicht nur falsch – das bekommen die Medizinstudierenden sofort mit und dann hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Wahl der Fachrichtung. Also: Den drohenden Nachwuchsmangel bekommen wir nur in den Griff, wenn sich auch die Ausbildungsbedingungen in allen Regionen verbessern.
änd Welche Rolle spielt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei der Entscheidung für oder gegen die Chirurgie?
BB Zweifelsohne eine große Rolle. Fragen in die Richtung kommen immer, wenn ich Sitzungen mit Studierenden besuche. Interessanterweise auch für die Männer ein immer wichtigerer Faktor. Ich bin der Überzeugung, dass die Kliniken mit kreativen Lösungen da vieles bewegen können. Dafür gibt es auch schon richtig gute Beispiele auch für chirurgische Kliniken, zum Beispiel die BG Klinik in Murnau. Das Kinderbetreuungsprogramm hier ist lange etabliert und für die Mitarbeiter extrem flexibel verfügbar. Die Zufriedenheit der Angestellten ist dadurch hoch und das Ganze lohnt sich dort den Berichten nach sogar wirtschaftlich – ein doppelter Gewinn. Es lohnt sich für die Kliniken, in diesem Bereich attraktiver zu werden und neue Weg zu gehen.
änd Sollten die Kliniken also auch in einen Wettbewerb um die beste Work-Life-Balance für die angestellten Ärzte einsteigen?
BB Gegen den Begriff Work-Life-Balance bin ich grundsätzlich etwas allergisch. Es impliziert ja, dass Arbeit und Leben gegensätzlich sind. Für die meisten Fälle arbeite ich aber sehr gerne und erachte den Beruf auch als Teil meines Lebens. Aber ich verstehe was hier gemeint ist und möchte daher auch antworten: Auf jeden Fall. Einen Trend in diese Richtung beobachten wir ja schon jetzt. Gute Chirurgen sind alles andere als im Überfluss vorhanden. Höchstens die Kammerzahlen sprechen von einer etwas steigenden Arztzahl in Deutschland. Da werden aber nur die Köpfe gezählt – nicht die Beschäftigungsverhältnisse, oder die zur Verfügung stehende Arztzeit. Ganz zu schweigen von der Motivation. Die Rahmenbedingungen müssen sich kontinuierlich verbessern, wenn die Kliniken als Arbeitgeber für den chirurgischen Nachwuchs attraktiv bleiben wollen.
änd Wie erleben Sie das Thema Bürokratie im Berufsalltag?
BB Ein schwieriges Thema – allerdings von Standort zu Standort unterschiedlich. Bei uns haben wir doch einige Sekretariate, die uns ein Stück weit entlasten. Es gibt aber auch viele Berichte aus Kliniken, die auf solche Strukturen nicht zurückgreifen. Da werden Dokumentations- und Sekretariatsaufgaben von Ärzten übernommen, deren Arbeitszeit dafür abseits der Patientenversorgung „verschwendet“ wird und – betriebswirtschaftlich gesehen – auch zu teuer ist. Das demotiviert und ist auch finanziell für die Kliniken unsinnig. Warum dies vielerorts noch nicht besser erkannt und mit höherer Priorität geändert wird ist mir ein Rätsel.
änd Werfen wir mal einen Blick in die Glaskugel: Immer wieder hört man von neuen technischen Entwicklungen in der Medizin. Haben wir in 20 oder 30 Jahren nur noch Roboter im OP-Saal und der Beruf des Chirurgen verschwindet nach und nach?
BB In der Unfallchirurgie hatte ich bislang noch wenige Berührungspunkte mit Operationsrobotern. Dabei sind zum Beispiel in der Urologie oder Allgemeinchirurgie Systeme wie der DaVinci-Roboter schon weiter verbreitet – die nach meinem Verständnis aber eher einen verlängerten, etwas präziseren Menschenarm darstellen. Bis zur voll automatisierten Robotik ohne wesentliches menschliches Zutun ist es sicherlich noch ein ganz weiter Weg aus verschiedensten Gründen. Letztendlich sind solche Entwicklungen hauptsächlich industriegetriggert. Wie sinnhaft solche Neuerungen sind, steht oft auf einem anderen Blatt. Sicher: Die Chirurgen verschließen sich neuen Entwicklungen nicht. Das Gegenteil ist der Fall, da im Zentrum immer das Interesse steht, den Patienten bestmöglich zu versorgen. Der Faktor Mensch in verantwortlicher Position kann in der Gleichung aber nie ganz herausgenommen werden – ich bin auch sicher, dass das im Sinne der Patienten ist. Meiner Meinung nach ist es Aufgabe der Ärzteschaft, genau zu schauen, wo die Sinnhaftigkeit neuer Verfahren liegt und sich zu beraten, Stellung zu beziehen, sowie sinnvolle Entwicklungsprozesse zu begleiten.
änd Im Moment kommen enorm viele Gesundheits- und Medizin-Apps auf den Markt. Fluch oder Segen für die Medizin?
BB Der Bundesgesundheitsminister ist offenbar ein großer Freund davon. Ich bin da etwas vorsichtiger. Letztendlich stehen immer bestimmte Algorithmen dahinter, die nie perfekt in allen Fällen arbeiten können, es liegen ja menschliche Daten zu Grunde. Selbst der „Supercomputer“ Watson von IBM wurde in den USA schon als Heilsbringer gefeiert und viele Unis haben das System gekauft. Inzwischen geben einige Standorte das Thema aber zunächst noch einmal auf, weil die Resultate nicht den Erwartungen entsprachen. Also: Neue Entwicklungen können Sinn machen. Wir sollten aber mit gesunder Skepsis und Augenmaß die Themen Datensicherheit und Nutzen bewerten und als Ärzte und Gesundheitsexperten solche Einführungsprozesse begleiten.
änd Das größte IT-Projekt im Gesundheitswesen ist ja hierzulande nach wie vor der Aufbau der TelematikInfrastruktur. Im Zuge dessen sollen die Notfalldaten der Patienten auch auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden. Eine sinnvolle Neuerung?
BB Ich denke schon. Nehmen wir beispielsweise die Situation, wenn ein Patient nach einem Unfall nicht ansprechbar ist. Dann können solche Informationen für die Arbeit in den Kliniken helfen: Hat der Patient eine spezielle Allergie oder Vorerkrankung? Das sind schon wichtige Angaben, die Einfluss auf die Wahl der besten Behandlungsmöglichkeit haben können. Ob es dann Sinn macht, dass die nur auf der Karte zu finden sind, die unter Umständen nicht mitgeführt wird, bleibt zu diskutieren. Grundsätzlich sollten diese Daten in einem sicheren System für die Häuser leicht abrufbar sein.
änd Was sind im Rahmen Ihrer Arbeit im BDC nun die nächsten Schritte und Projekt?
BB Da läuft im Moment sehr viel. Wir arbeiten zum Beispiel an ganz konkreten Projekten für die Studierenden und die Verbesserungen der Lehrbedingungen/Möglichkeiten. Auch wollen wir die chirurgischen Nachwuchsvertreter über mehrere Organisationen hinweg besser verknüpfen. Ganz konkret gibt es dazu ein Netzwerk-Projekt der DGCH, bei dem wir eine Online-Landkarte von Deutschland aufbauen – und den Studierenden zeigen, wo sie in unmittelbaren Kontakt mit erfahrenen Mentoren jeglicher chirurgischer Fachgebiete treten können. Da erschaffen wir neue Möglichkeiten, die PJ und Famulatur so nicht bieten können und darüber hinaus auch die jungen Chirurgen der verschiedenen Fachgebiete verbindet. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Schritte.
Braun BJ: „Die Ausbildungsbedingungen müssen sich in allen Regionen verbessern“. Passion Chirurgie. 2019 Juni, 9(06): Artikel 04_02.
Quelle: änd Ärztenachrichtendienst Verlags-AG, https://www.aend.de/article/195018