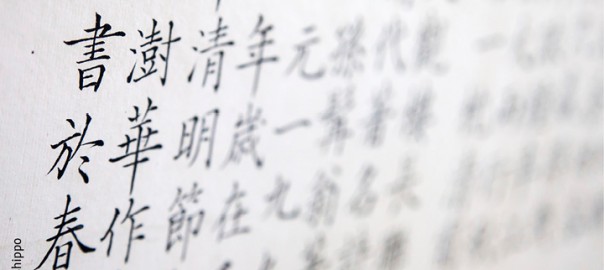Chirurg und Anästhesist erfüllen bei ihrer präoperativen, intraoperativen und postoperativen Zusammenarbeit eine gemeinsame Aufgabe im Dienste des Patienten. Ihre Kooperation auf der Grundlage präziser Aufgabenteilung und wechselseitigen Vertrauens bietet die beste Gewähr für die Ausschaltung vermeidbarer Risiken sowie für eine reibungslose und zügige Abwicklung des Operationsprogrammes. Damit entspricht diese Zusammenarbeit auch den Erfordernissen einer wirtschaftlichen Behandlungsweise, die jedoch weder die Sicherheit des Patienten noch den Therapieerfolg beeinträchtigen darf.
Das Ziel beider Berufsverbände ist es, im Geiste kollegialen Einverständnisses und in ständiger wechselseitiger Konsultation das interdisziplinäre Zusammenwirken überall dort noch zu verbessern, wo in der täglichen Arbeit Zweifelsfragen und Meinungsverschiedenheiten auftreten können.
Sie vereinbaren deshalb in Erweiterung und Ergänzung der bestehenden Abkommen folgende Leitsätze für die Zusammenarbeit von Chirurgen und Anästhesisten in der prä-, intra- und unmittelbaren postoperativen Phase.
Leitsätze für die Zusammenarbeit von Chirurgen und Anästhesisten in der prä-, intra- und unmittelbaren postoperativen Phase
Der Chirurg ist nach den Grundsätzen einer strikten Arbeitsteilung zuständig und verantwortlich für die Planung und Durchführung des operativen Eingriffs, der Anästhesist für die Planung und Durchführung des Anästhesieverfahrens sowie für die Überwachung und Aufrechterhaltung der vitalen Funktionen. Beide Ärzte dürfen, solange keine offensichtlichen Qualifikationsmängel oder Fehlleistungen erkennbar werden, wechselseitig darauf vertrauen, dass der Partner der Zusammenarbeit die ihm obliegenden Aufgaben mit der gebotenen Sorgfalt erfüllt.
1. Präoperative Phase
1.1 Der Chirurg entscheidet über die Indikation zum Eingriff sowie über Art und Zeitpunkt der Operation. Der Anästhesist unterrichtet den Chirurgen umgehend, wenn aus der Sicht seines Fachgebietes Bedenken gegen den Eingriff oder seine Durchführung zu dem vorgesehenen Zeitpunkt erkennbar werden.
Die Entscheidung, ob der Eingriff dennoch durchgeführt werden muss oder aufgeschoben werden kann, obliegt dem Chirurgen. Wenn sich dieser entgegen den Bedenken des Anästhesisten für den Eingriff entschließt, so übernimmt er damit die ärztliche und rechtliche Verantwortung für die richtige Abwägung der indizierenden Faktoren und der ihm vom Anästhesisten mitgeteilten Bedenken. Der Anästhesist hat in diesem Falle bei der Wahl und Durchführung des Anästhesieverfahrens dem erhöhten Risiko und Schwierigkeitsgrad Rechnung zu tragen.
1.2 Art und Umfang der präoperativen Untersuchungen sind abhängig vom Alter und Allgemeinzustand des Patienten sowie von der Belastung durch den operativen Eingriff. Die „Gemeinsamen Empfehlungen“ der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin zur präoperativen Evaluation erwachsener Patienten vor elektiven, nicht kardiochirurgischen Eingriffen in ihrer jeweils aktuellen Fassung sind zu beachten [2].
Für den Regelfall empfiehlt sich eine Abstimmung zwischen Chirurg und Anästhesist über ein Untersuchungsprogramm. Das Ziel der Abstimmung soll es sein, standardisierte, planbare Abläufe zu erreichen, die dem aktuellen medizinischen Kenntnisstand und den medikolegalen Rahmenbedingungen (Zeitpunkt der Aufklärung) Rechnung tragen. Dabei ist zu bedenken, dass der Anästhesist für die Voruntersuchung und eine etwaige Vorbehandlung, für die Aussprache mit dem Chirurgen über das geplante operative und anästhesiologische Vorgehen sowie über mögliche Kontraindikationen, für das Aufklärungsgespräch mit dem Patienten und für die Prämedikation Zeit benötigt. Der Chirurg sollte deshalb den Anästhesisten zum frühestmöglichen Zeitpunkt über den beabsichtigten Eingriff unterrichten, in der Regel also, sobald er bei einem Patienten über die Indikation zum operativen Eingriff entschieden hat, und ihm möglichst bald auch die vollständigen Behand¬lungs¬unterlagen zur Verfügung stellen. Andererseits ist es Aufgabe des Anästhesisten, die ihm gebotene Gelegenheit wahrzunehmen, um Verzögerungen des Operations¬programmes zu vermeiden.
1.3 Das Operationsprogramm des nächsten Tages sollte dem Anästhesisten spätestens am frühen Nachmittag vorliegen, um während der restlichen Tagesdienstzeit nicht nur die anstehenden Prämedikationsgespräche vornehmen, sondern auch notwendig erscheinende Zusatzuntersuchungen durchführen lassen zu können.
1.4 Chirurg und Anästhesist klären den Patienten jeweils über die Maßnahmen ihres Verantwortungsbereichs auf. In Risikofällen kann sich die gemeinsame Aufklärung des Patienten durch Chirurg und Anästhesist empfehlen.
1.5 Meinungsverschiedenheiten über den Eingriff und seine Voraussetzungen sollten zwischen Chirurg und Anästhesist und nicht vor dem Patienten erörtert werden.
2. Zuständigkeit für die Wahl und Durchführung des Anästhesieverfahrens
2.1 Der Chirurg kann nach der Weiterbildungsordnung für das Fachgebiet Chirurgie und dessen Zusatzweiterbildungen Verfahren der Lokal- und Regionalanästhesie sowie Analgesierungs- und Sedierungsmaßnahmen eigenverantwortlich durchführen. Es besteht Einvernehmen, dass ein Anästhesist hinzugezogen wird, wenn der Eingriff selbst oder das erforderliche Betäubungsverfahren die Vitalfunktionen gefährden können.
2.2 Ob ein Anästhesist für die Durchführung des geplanten Eingriffs hinzugezogen wird, entscheidet der Chirurg. Er berücksichtigt dabei die Art des Eingriffs, die möglichen Verfahren zur Analgesie/Sedierung/Anästhesie, den Zustand des Patienten und ggf. dessen Wünsche.
2.3 Eine Beteiligung des Anästhesisten ist immer dann erforderlich, wenn bei der Durchführung eines Eingriffs die Vitalfunktionen und Schutzreflexe des Patienten beeinträchtigt oder in besonderem Maße gefährdet werden können. Eine Beeinträchtigung bzw. Gefährdung der Vitalfunktionen resultiert insbesondere aus Art und Umfang des erforderlichen Anästhesieverfahrens, aus dem durchzuführenden Eingriff und seinen besonderen Erfordernissen, aus der Schwere der Grund- und Begleiterkrankungen des Patienten und vor allem aus einer Interaktion dieser Faktoren.
Ein Anästhesist ist also immer erforderlich bei allen Allgemeinanästhesien (mit Verlust des Bewusstseins und der Schutzreflexe) sowie bei allen rückenmarksnahen Leitungsanästhesien (SpA, PDA), z. B. wegen der gleichzeitig auftretenden Sympathikolyse. [3]
2.4 Der Anästhesist entscheidet über die Art des Anästhesieverfahrens. Wenn keine medizinischen Gründe entgegenstehen, sollten Anästhesist und Chirurg auf die Wünsche und Vorstellungen des Partners wechselseitig Rücksicht nehmen.
3. Lagerung des Patienten auf dem Operationstisch
Zur Verantwortung für die prä-, intra- und postoperative Lagerung des Patienten gibt es eine separate Vereinbarung von BDA und BDC [4].
4. Planung und Durchführung des Operationsprogramms
4.1 Das Operationsprogramm sollte so geplant werden, dass es nach den bisherigen Erfahrungen innerhalb der Regelarbeitszeit abgewickelt werden kann.
4.2 Zeitverluste beim Beginn des Operationsprogramms und Verzögerungen in seiner Abwicklung sind durch eine enge Koordination der Zeitpläne und wechselseitige Rücksichtnahme zu vermeiden. Hierzu ist es u. a. erforderlich, dass festgelegte Zeiten von allen Beteiligten in gleicher Weise als verbindlich angesehen werden. Störfaktoren und Fehlerquellen, die eine zügige Abwicklung des Operationsprogramms behindern, sollten gemeinsam ermittelt und im vertrauensvollen interdisziplinären Gespräch offen erörtert werden. Dienstbesprechungen, Weiterbildungsprogramme und Fortbildungsveranstaltungen sollten im wechselseitigen Einverständnis so eingeplant werden, dass sie das Operationsprogramm nicht beeinträchtigen. Es empfiehlt sich, hierfür eine übereinstimmende Terminierung vorzusehen.
4.3 Bei der Organisation des Dienstbetriebes und bei allen Planungen ist in Rechnung zu stellen, dass die Versorgung von Notfällen Chirurgen und Anästhesisten zusätzlich in Anspruch nimmt.
4.4 BDA und BDC unterstützen die Initiative „Safe Surgery saves Lives“ der Weltgesundheitsorganisation [5] und empfehlen die routinemäßige Verwendung einer entsprechenden Checkliste.
5. Aufgabenverteilung in der postoperativen Phase
5.1 Für Maßnahmen zur Überwachung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der durch das operative Vorgehen beeinträchtigten Vitalfunktionen sind grundsätzlich beide Fachgebiete fachlich zuständig, der Anästhesist für die Erkennung und Behandlung spezifischer Anästhesienebenwirkungen, der Chirurg für die Erkennung und Behandlung chirurgischer Komplikationen.
Beide Ärzte haben wechselseitig dafür zu sorgen, dass bei Komplikationen der fachlich zuständige Arzt umgehend zur Mitbehandlung zugezogen wird. Jeder der beteiligten Ärzte trägt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Unterweisung und Beaufsichtigung des ihm unterstellten Pflegepersonals.
Nach Anästhesien im Zusammenhang mit diagnostischen und therapeutischen Eingriffen kann der Patient durch die Auswirkung des Anästhesieverfahrens (unter Umständen auch des Eingriffs) auf die vitalen Funktionen noch für einige Zeit akut gefährdet sein. In dieser „Erholungsphase“ bedarf der Patient einer kontinuierlichen und kompetenten Überwachung.
5.2 Zur Patientensicherheit in dieser Phase fordern Chirurgen und Anästhesisten nachdrücklich die Vorhaltung von Aufwacheinheiten.
5.3 In jedem Fall verbleibt der Patient vor einer Verlegung auf eine Regelpflegestation so lange unter Überwachung, bis er wieder im Vollbesitz seiner Schutzreflexe ist und keine unmittelbaren Komplikationen von Seiten der vitalen Funktionen mehr zu erwarten sind [6]. Wann ein Patient aus der Überwachung entlassen werden kann, hängt auch von der qualitativen und quantitativen personellen Besetzung und damit Leistungsfähigkeit der nachbehandelnden Struktur ab.
Mit der dokumentierten Übergabe des Patienten durch den Anästhesisten an das Personal der nachbehandelnden chirurgischen Einheit übernimmt der Chirurg mit seinem Personal die alleinige Verantwortung für die weitere Überwachung des Patienten.
Bei Verlegung direkt nach Hause im Rahmen ambulanter Versorgungen müssen weitere Kriterien erfüllt sein [7].
Referenzen
[1] Vereinbarung über die Zusammenarbeit bei der operativen Patientenversorgung des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten und des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen. Anästh. Intensivmed. 23 (1982) 403 – 405.
[2] Präoperative Evaluation erwachsener Patienten vor elektiven, nicht kardiochirurgischen Eingriffen – Gemeinsame Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin. Anasth. Intensivmed. 51 (2010) S788 – S797.
[3] Ärztliche Kernkompetenz und Delegation in der Anästhesie*
Entschließung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V. und des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten e.V. vom 26.10.2007 / 08.11.2007. Anästh. Intensivmed. 48 (2007) 712 – 71.
[4] Verantwortung für die prä-, intra- und postoperative Lagerung des Patienten. Vereinbarung des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten und des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen. Anästh. Intensivmed. 28 (1987) 65.
[5] WHO Initiative „Safe Surgery safes lives“. http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en/ (abgerufen 18.01.2016).
[6] Überwachung nach Anästhesieverfahren. Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin und des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten. Anästh. Intensivmed. 50 (2009) S.486 – S.489.
[7] Vereinbarung zur Qualitätssicherung ambulante Anästhesie des Berufsverbandes Deutscher Anästhesisten, der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin und des Berufsverbandes der Deutschen Chirurgen. Anästh. Intensivmed. 46 (2005) 36 – 37 sowie Anästh. Intensivmed. 47 (2006) 50 – 51.