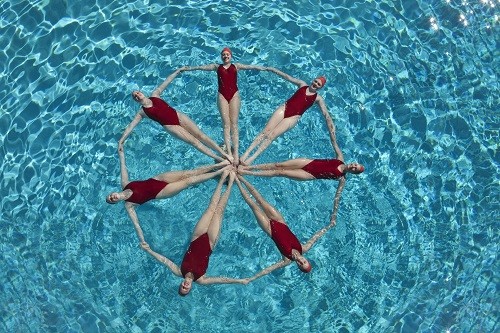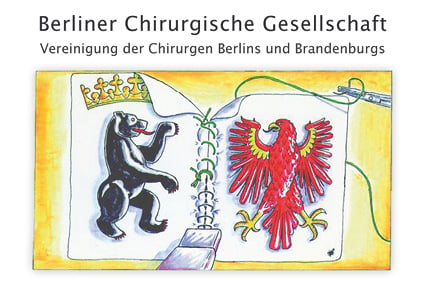Der in Berlin vorgestellte Herzbericht 2016 bestätigt, dass die herzchirurgische Versorgung bundesweit mit 78 Abteilungen auf hohem Qualitätsniveau etabliert ist. Die Verbesserung der Lebenserwartung – und insbesondere auch der Lebensqualität – der Patienten ist eine wesentliche Prämisse für die in Deutschland knapp 1.000 tätigen Herzchirurgen. „Insgesamt wurden im Jahr 2015 in Deutschland 128.175 Herzoperationen durchgeführt“, erläutert PD Dr. Wolfgang Harringer, erster Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG). „Trotz des kontinuierlichen Anstiegs des Lebensalters, und den damit einhergehenden Begleiterkrankungen, liegen die Überlebensraten der Patienten dank der kontinuierlichen Weiterentwicklungen bestehender, und Initiierung minimalinvasiver, schonenderer Operationsverfahren, weiterhin bei ca. 97 Prozent.“
Selbstverständlich hat der demographische Wandel auch einen Einfluss auf die Entwicklung der Herzchirurgie. „Seit 1990 ist ein kontinuierlicher Anstieg von Patienten höheren Alters zu beobachten“, erklärt Herzchirurg Harringer. Im Jahr 2015 waren bereits 15 Prozent aller herzchirurgischen Patienten mindestens 80 Jahre alt. Betrachtet man alle Herzerkrankungen, ist festzustellen, dass die Prävalenz bei Männern höher ist. Beispielsweise waren die Patienten mit koronarer Herzerkrankung, die eine Bypass-Operation erhielten, in 78 Prozent Männer und nur in 22 Prozent Frauen (2015). Die Herzchirurgie leistet mit vielfältigen Verfahren und patientenindividuellen Therapien bedeutende Beiträge in der Herzmedizin. Umso mehr begrüßt die DGTHG die obligate Umsetzung interdisziplinärer Herzteams.
Entscheidung im Herzteam: bestmögliche Patientenversorgung und -sicherheit
Interdisziplinärer Austausch und fachgebietsübergreifende Kooperation bedeuten für den Patienten in jedem Fall die bestmögliche Option und führen zu einer auf ihn abgestimmten Therapieempfehlung. Aus diesem Grund sind mit Blick auf die hochwertige medizinische Versorgung Herzteams – im Kern bestehend aus Herzchirurgen, Kardiologen, Kinderkardiologen und Anästhesisten – die optimale personelle Basis für eine erfolgreiche Patientenbehandlung. Das „Herz-Team-Konzept“ ist in zahlreichen nationalen und internationalen Leitlinien explizit als ein wesentlicher Faktor der Patientenversorgung ausgewiesen (Guidelines on myocardial revascularisation ESC/EACTS 2014; aktualisierte Nationale Versorgungsrichtlinie chronische Koronare Herzkrankheit 2016). „Wir begrüßen das empfohlene Herzteam-Konzept ausdrücklich, dies im Hinblick auf alle Therapieverfahren in der Herzmedizin. Für die Behandlung der Koronaren Herzkrankheit gibt es aus Sicht der Herzchirurgen noch Verbesserungspotential“, so Harringer.
Koronare Herzkrankheit (KHK) und Herzchirurgie: in 90 Prozent aller Fälle sind Verkalkungen die Ursache der Herzerkrankung
Die Koronare Herzkrankheit als Erkrankung der Arterien des Herzens ist die häufigste Todesursache in den westlichen Industrieländern. Ablagerungen an den Gefäßwänden (Plaques) verursachen die Arterienverkalkung (Arteriosklerose) und damit Gefäßverengungen (Stenosen) bis hin zu Verschlüssen, welche zu einer Mangelversorgung des Herzens mit Sauerstoff führen. In 10 Prozent aller Fälle sind andere Ursachen verantwortlich für die Entstehung der KHK. Die Folgen können von der Angina pectoris über Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzinfarkt reichen. Die stationäre Morbiditätsziffer der KHK hat von 2013 bis 2015 nur marginal um 0,8% abgenommen (2013: 807,1; 2015:800,5). Das patientenindividuelle Versorgungskonzept der Koronaren Herzkrankheit richtet sich nach diversen Parametern.
Bypass-Operation: besonders vorteilhaft bei komplexen Gefäßverengungen, kein Patientenhöchstalter für Operationen; Diabetes-Patienten profitieren überproportional
Bei komplexen koronaren Mehr-Gefäßerkrankungen und/oder Hauptstammstenose (Verengung der großen Herzkrangefäße im Ursprungsteil) besteht eine klare Indikation für die koronare Bypass-Operation. Dies sowohl bezogen auf die Beschwerdefreiheit und insbesondere auch im Hinblick auf die Überlebensrate und Lebensqualität (siehe 5-Jahres-Ergebnisse der Syntax-Studie) der betroffenen Patienten. „Patienten jeglichen Alters können herzchirurgisch revaskularisiert werden“, betont Harringer. „Es gibt keine fixe Altersobergrenze. 2015 machte die Altersgruppe der ab 70+ Jahre 48,4 Prozent aller koronaren Bypass-Patienten aus.“ Männer sind in allen Altersgruppen häufiger betroffen als Frauen – nur jede vierte Frau erhält eine koronare Bypass-Operation. Insgesamt wurden 2015 bundesweit rund 52.000 isolierte und kombinierte Bypass-Operationen durchgeführt.
„Welches Verfahren für den Patienten das bestmögliche ist, muss im interdisziplinären Kompetenzteam – dem Herzteam – entschieden werden. Die im Jahr 2014 aktualisierte ESC/EACTS „Guidelines on myocardial revascularisation“ bestätigt ebenso wie die Nationale Versorgungsleitlinie chronische KHK die Konzeption der Kooperation und Entscheidungsfindung im Herz-Team“, betont Harringer. „Jeder Patient muss individuell und im Kontext seines Herzleidens, wie auch seiner Begleiterkrankungen betrachtet und beraten werden. Zum Beispiel profitieren Patienten mit Diabetes mellitus überproportional von einer koronaren Bypass-Operation im Vergleich zu anderen Therapiekonzepten. Für multimorbide Hochrisikopatienten im hohen Lebensalter kann durchaus auch eine Intervention das Mittel der ersten Wahl sein. Wie konsequent und erfolgreich sich die Zusammenarbeit im Herzteam gestalten kann, sieht man an der seit mehreren Jahrzehnten praktizierten engen Zusammenarbeit und Abstimmung von Herzchirurgen und Kinderkardiologen bei der Behandlung von Patienten mit angeborenen Herzfehlern.“
Herzklappenchirurgie: kontinuierlicher Anstieg der Eingriffe; Mitralklappe kann zumeist rekonstruiert werden, G-BA Richtlinie etabliert Herzteam bei TAVI und Mitral Clip
Europaweit gehört die Verengung der Aortenklappe (Aortenklappenstenose) zu den häufigsten Herzklappenerkrankungen, die verschleißbedingt, insbesondere im hohen Lebensalter, auftritt. „Die Aortenklappenstenose ist derzeit die häufigste invasiv therapierte Herzklappenerkrankung, gefolgt von der Mitralklappeninsuffizienz. Insgesamt stieg 2015 die Anzahl der Herzklappeneingriffe um ca. 3 Prozent auf 32.346 (2014: 31.359) an. 11.183 dieser Eingriffe waren im Jahr 2015 konventionelle Aortenklappenersatz-Operationen“, erklärt Harringer. Mit 6.027 isolierten Mitralklappen-Operationen setzte sich der kurative Ansatz auch im 2015 fort: Bei rund zwei Drittel (63,6 Prozent) der Operationen konnte die patienteneigene Herzklappe rekonstruiert, und in ihrer Funktion wiederhergestellt werden. Biologische oder mechanische Mitralklappen-Prothesen waren in 36,4 % aller Fälle notwendig.
Neben den konventionellen Operationsverfahren bieten minimalinvasive kathetergestützte Techniken (TAVI und Mitral Clip) eine schonende Alternative für ausgewählte Patienten höheren Lebensalters in Kombination mit erheblichen Begleiterkrankungen. Die Zahl kathetergestützter Aortenklappenimplantationen (TAVI) im Jahr 2015 beträgt laut des deutschen Herzberichtes 15.573. „Die kathetergestützte Aortenklappen-implantation und die transvenöse Clip-Rekonstruktion der Mitralklappe unterliegen in Deutschland besonderen Voraussetzungen und dürfen seit dem 20. Juli 2015 nur nach interdisziplinärem Konsens des etablierten Herzteams mit festgelegten Prozessen und verbindlich definierter Infrastruktur durchgeführt werden“, erklärt PD Dr. Harringer. „So sieht es die Richtlinie zu minimalinvasiven Herzklappeninterventionen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) vor. Wir begrüßen dies ausdrücklich.“
Neues Rekordtief: Mangel an Spenderherzen
Die dramatische Entwicklung bei den Herztransplantationen setze sich auch mit einem Rekordtief im Jahr 2015 fort. Wurden 2014 noch 294 Herztransplantationen durchgeführt, so sank die Anzahl weiter auf 283 im Jahr 2015. Zwar werden nach Angaben der DGTHG Herzunterstützungssysteme, welche als Alternative oder als Überbrückung bei mehr als 90 Prozent der Patienten implantiert werden, immer leistungsfähiger, stellen jedoch keinen adäquaten bzw. vollumfänglichen Ersatz für ein Spenderherz dar. „Aufgrund ihrer lebensbedrohlichen Erkrankung müssen viele der schwerst-herzkranken Patienten meist mehrere Monate im Krankenhaus oder gar auf einer Intensivstation auf die lebensrettende Transplantation warten“, erklärt Herzchirurg Harringer. „Alle Beteiligten sollten daher weiter an die Spendebereitschaft der Bevölkerung appellieren.“