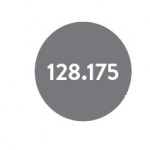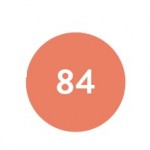Die Videosprechstunde kann als neue telemedizinische Leistung ab April und somit eher als vorgesehen durchgeführt werden. KBV und GKV-Spitzenverband haben sich im Bewertungsausschuss auf eine Vergütungsregelung geeinigt und eine entsprechende Anpassung des EBM beschlossen.
Nunmehr steht auch fest, bei welchen Krankheitsbildern eine Videosprechstunde zur Verlaufskontrolle in Frage kommt. Zudem wurden die Arztgruppen festgelegt, die die Videosprechstunde einsetzen und abrechnen können. Bereits im November vorigen Jahres hatten sich KBV und GKV-Spitzenverband auf die technischen Anforderungen für die Praxis und den Videodienst geeinigt (Anlage 31b zum Bundesmantelvertrag-Ärzte). Auf dieser Grundlage wurde nunmehr die Anpassung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) vorgenommen.
Technik- und Förderzuschlag von bis zu 800 Euro
Für Videosprechstunden erhalten Praxen bis zu 800 Euro jährlich pro Arzt. Ab April gibt es für jede Videosprechstunde einen Technikzuschlag von 4,21 Euro (GOP 01450, Bewertung: 40 Punkte). Dieser wird für bis zu 50 Videosprechstunden im Quartal gezahlt, auch mehrmals im Behandlungsfall.
Diese Mittel – bei vier Videosprechstunden pro Woche – dienen zur Hälfte zur Deckung der Kosten, die durch die Nutzung eines Videoanbieters anfallen; die andere Hälfte der Förderung von Videosprechstunden.
Der Bewertungsausschuss geht davon aus, dass eine Kostendeckung bereits bei zwei Videosprechstunden pro Woche erreicht ist. Die Lizenzgebühren für Videodienste liegen aktuell bei etwa 100 Euro im Quartal.
Neue GOP bei Arzt-Patienten-Kontakt nur per Video
Videosprechstunden sollen eine persönliche Vorstellung in der Praxis ersetzen. Die Konsultation ist deshalb Inhalt der Versicherten- beziehungsweise Grundpauschale und somit nicht gesondert berechnungsfähig. Für Fälle, bei denen der Patient in einem Quartal nicht die Praxis aufsucht, wurde eine analoge Regelung zum telefonischen Arzt-Patienten-Kontakt vereinbart: Ärzte rechnen hier die neue GOP 01439 ab; sie wird ebenfalls zum 1. April in den EBM aufgenommen.
Die GOP 01439 ist mit 88 Punkten (9,27 Euro) bewertet und kann einmal im Behandlungsfall abgerechnet werden, wenn der Patient in den vorangegangenen zwei Quartalen mindestens einmal in der Praxis persönlich vorstellig geworden ist und die Verlaufskontrolle durch dieselbe Praxis erfolgt wie die Erstbegutachtung. Diese Vorgabe ist notwendig, weil Ärzte sonst gegen das Fernbehandlungsverbot verstoßen könnten.
Persönlichen Kontakt durch Videosprechstunde ersetzen
Außerdem wurde vereinbart, dass für eine Reihe von Gebührenordnungspositionen, die mindestens drei persönliche Arzt-Patienten-Kontakte im Behandlungsfall voraussetzen, einer dieser Kontakte auch im Rahmen einer Videosprechstunde stattfinden kann. Dies gilt unter anderem für die Behandlung von Wunden, eines Decubitus und Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates.
Anlässe für eine Videosprechstunde
Für eine Videosprechstunde sind aus Sicht des Bewertungsausschusses nicht alle Krankheitsbilder geeignet, weshalb die Leistung zunächst nur für bestimmte Indikationen vergütet wird. Dazu zählen die visuelle Verlaufskontrolle von Operationswunden, Bewegungseinschränkungen und -störungen des Stütz- und Bewegungsapparates sowie die Kontrolle von Dermatosen, einschließlich der diesbezüglichen Beratung. Daneben kann auch die Beurteilung der Stimme, des Sprechens oder der Sprache per Videosprechstunde erfolgen. Eine Erweiterung des Leistungsspektrums ist vorgesehen.
Grundlage für die Festlegung der Krankheitsbilder waren Erfahrungsberichte aus verschiedenen Pilotprojekten. Zudem schreibt der Gesetzgeber vor, dass Videosprechstunden nur für Verlaufskontrollen bei bekannten Patienten gefördert werden sollen.
Festgelegt wurden auch die Arztgruppen, die Videosprechstunden einsetzen und abrechnen können. Dies sind unter anderem Hausärzte, Kinder- und Jugendärzte sowie bestimmte weitere Facharztgruppen wie Haut- und Augenärzte, Chirurgen und Orthopäden.
Anforderungen an Videodienstleister
Ärzte, die Videosprechstunden anbieten wollen, bedienen sich eines Videodienstanbieters. Dieser muss über entsprechende Sicherheitsnachweise verfügen. So muss die Videosprechstunde während der gesamten Übertragung nach dem Stand der Technik Ende-zu-Ende verschlüsselt sein. Ferner ist festgelegt, dass die apparative Ausstattung der Praxis und die elektronische Datenübertragung eine angemessene Kommunikation mit dem Patienten gewährleisten müssen. Näheres ist in der Anlage 31b zum Bundesmantelvertrag-Ärzte geregelt.
Im E-Health-Gesetz war vorgesehen, dass Videosprechstunden ab 1. Juli 2017 finanziell gefördert werden. Durch den frühzeitigen Vertragsabschluss zur Vergütung kann das neue Angebot bereits drei Monate eher an den Start gehen.
Videosprechstunden können bei folgenden Anlässen durchgeführt werden:
- Visuelle postoperative Verlaufskontrolle einer Operationswunde
- Visuelle Verlaufskontrolle einer/von Dermatose(n), auch nach strahlentherapeutischer Behandlung
- Visuelle Verlaufskontrolle einer/von akuten, chronischen und/oder offenen Wunden
- Visuelle Beurteilung von Bewegungseinschränkungen/-störungen des Stütz- und Bewegungsapparates, auch nervaler Genese, als Verlaufskontrolle
- Beurteilung der Stimme und/oder des Sprechens und/oder der Sprache als Verlaufskontrolle
- Anästhesiologische, postoperative Verlaufskontrolle