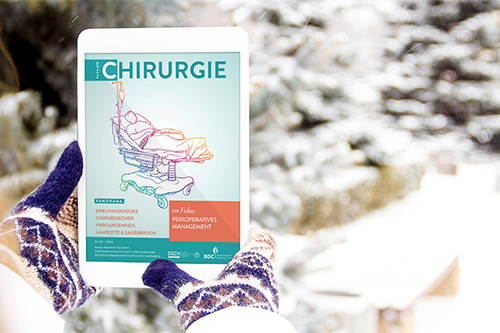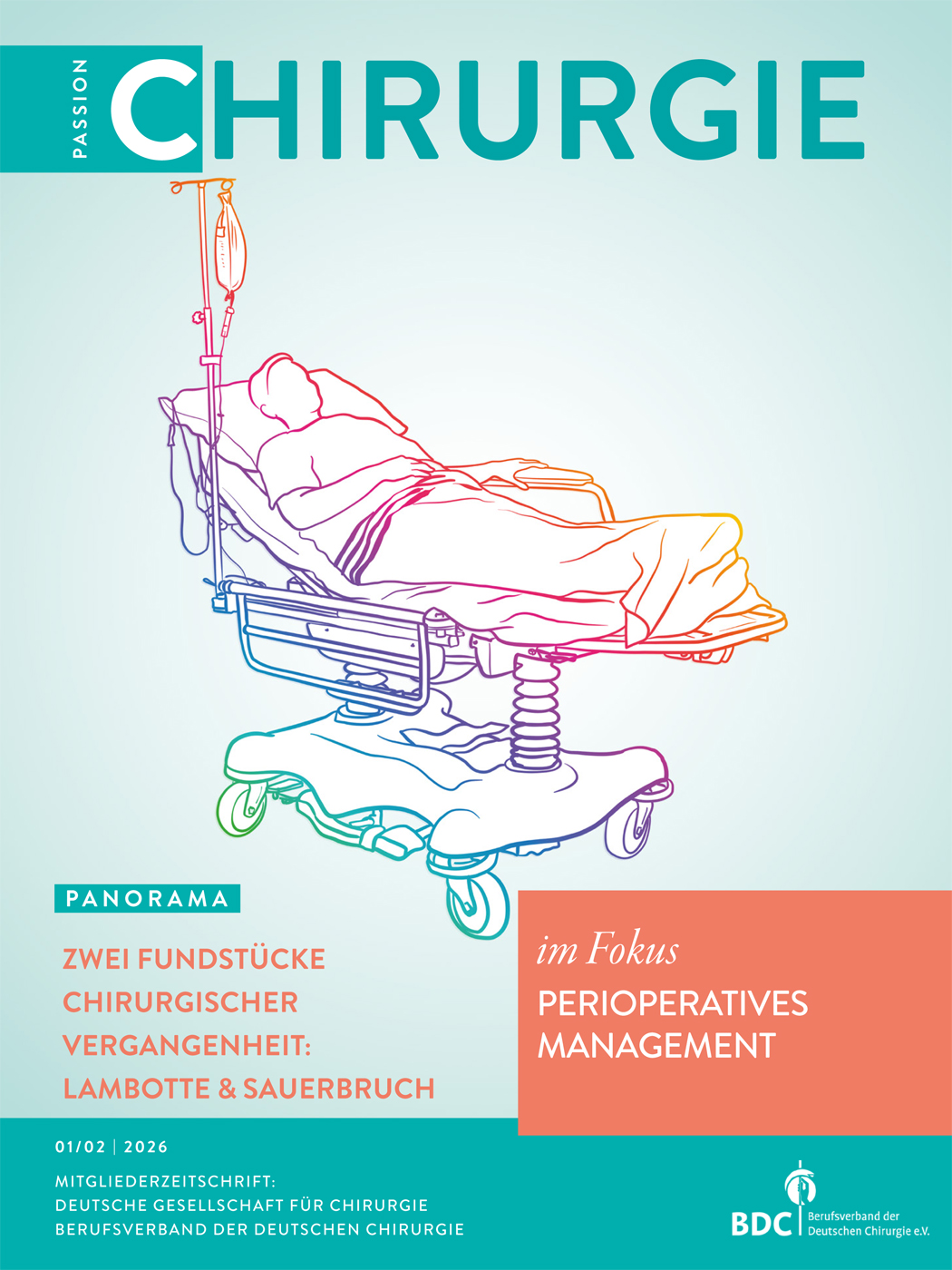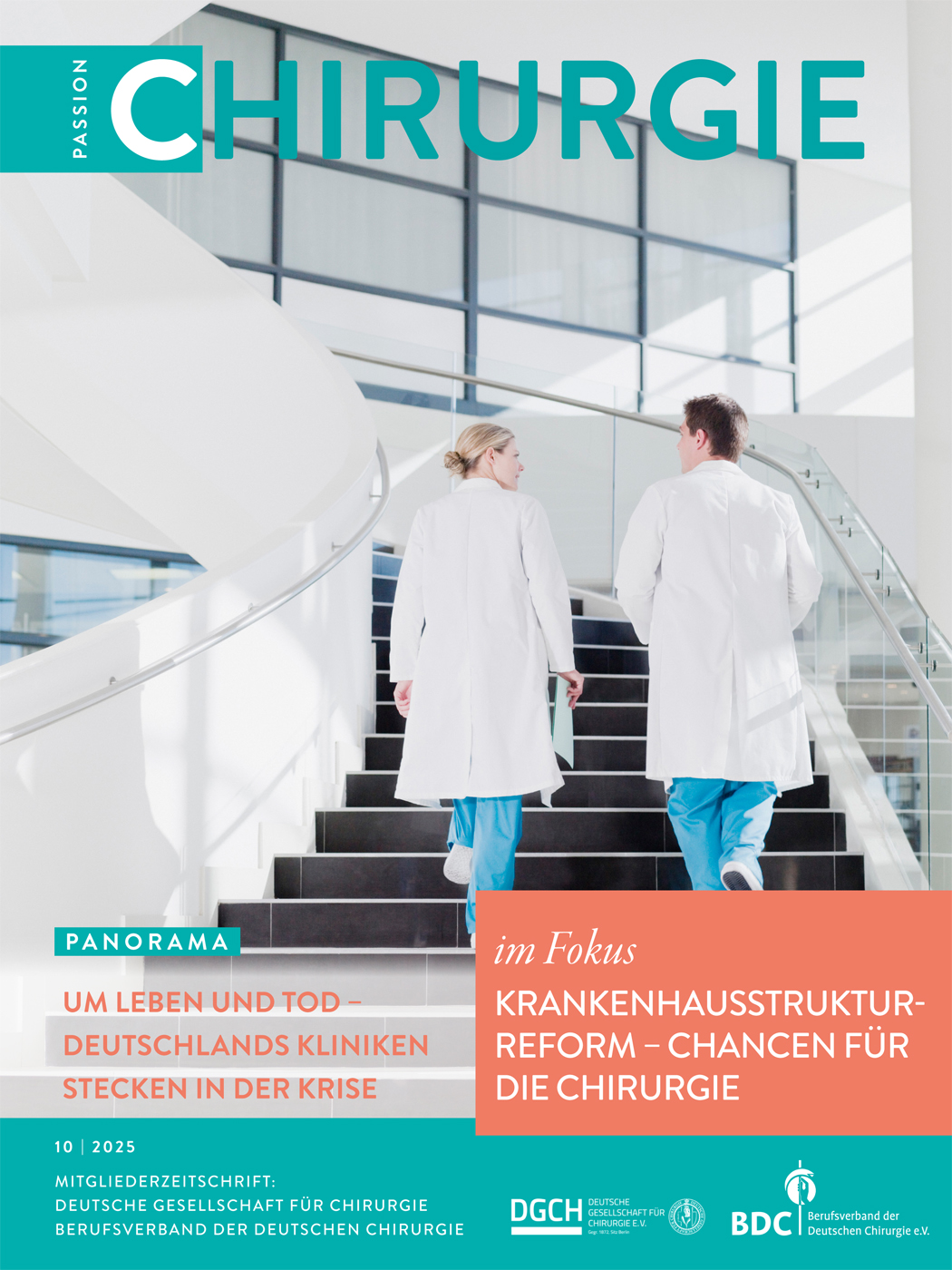01.05.2025 Fachübergreifend
Was benötigen spezialisierte Leistungserbringer zur Behandlung schwer heilender und chronischer Wunden von Chirurg:innen für eine gute Zusammenarbeit

Wunden haben immer eine Ursache. Sie sind Folge eines Ereignisses oder Symptom einer Erkrankung. Interne Faktoren, wie zum Beispiel Erkrankungen der Atemwege, des Verdauungs-, Herz-Kreislauf-, des Immunsystems oder Funktionsverlust der Haut können zusätzlich die physiologischen Mechanismen der Wundheilung stören. Aus dieser Tatsache leitet sich folgerichtig die Erkenntnis ab, dass ohne eine erfolgreiche Behandlung der Wundursache sowie der Behandlung beeinflussender Begleiterkrankungen eine Wunde nicht abheilen kann.
Neben den medizinischen Herausforderungen können schwer heilende Wunden bei den Betroffenen zu erheblichen physischen, psychischen und sozialen Belastungen führen. Am häufigsten sind hier Schmerzen, Mobilitätsverlust, hohe Exsudatmengen, Geruch und daraus resultierend ein Verlust sozialer Teilhabe zu nennen. [1]
Erschwerend können externe Faktoren, wie beengte, unhygienische Wohnsituationen, mangelnde finanzielle Ressourcen, unzureichende sanitäre Ausstattung oder mangelnde Selbstfürsorge hinzukommen. Aus all diesen Aspekten ergibt sich ein individuelles Risikoprofil, welches die Komplexität und den Umfang des jeweiligen Behandlungspfades beeinflusst.
Daraus lässt sich ableiten, dass die Behandlung schwer heilender und chronischer Wunden einer interdisziplinären und interprofessionellen Versorgungsstruktur bedarf.
Um alle heilungsfördernden Aspekte strukturiert und zielorientiert zu verzahnen bedarf es einer vertrauensvollen, vernetzten, interdisziplinären und interprofessionellen Versorgung durch Leistungserbringer mit spezialisierter Fachexpertise. Dazu zählen die Berufsgruppen Ärzte/Ärztinnen, Pflegefachpersonen, Podolog:innen, Physiotherapeut: innen, etc.
Die Zusammenarbeit stützt sich dabei auf:
- eine strukturierte, umfassende ärztliche Anamnese und Diagnostik zur Ermittlung der Wundursache und beeinflussender Nebenerkrankungen sowie deren Therapien, Differentialdiagnostik.
- eine strukturierte, umfassende pflegerische Anamnese zur Ermittlung von Wundheilung beeinflussenden Faktoren mit Bezug auf die psychosoziale Lebenssituation, Hygiene, Lebensqualität und Selbstpflegekompetenz.
- die Beurteilung der individuellen Risiken für die Wundheilung und die Erarbeitung von darauf basierenden Therapiezielen unter Beachtung der Patientenpräferenzen.
- eine evidenzbasierte Therapieplanung und fachgerechte Umsetzung.
- die Edukation zu krankheitsspezifischen Risikofaktoren, Umgang mit der Erkrankung im Alltag, Wundheilungsfördernder Maßnahmen, sowie der notwendigen psychosozialen Unterstützung und Hilfe zur Bewältigung individueller Probleme im Zusammenhang mit der Erkrankung.
- eine digital gestützte, gemeinsame, vollständige, plausible und evaluierbare Dokumentation der aktuellen Wundsituation, sowie der Maßnahmen zur Therapiezielerreichung.
- eine regelhafte Evaluation der Therapie und deren bedarfsgerechte Anpassung.
- eine strukturierte Überleitung zwischen den Sektoren, die geplante Nachsorge und ggf. dem Einleiten rehabilitativer Maßnahmen.
Grundlage interdisziplinärer Zusammenarbeit
Bis 2017 war die ambulante pflegerische Wundversorgung auf Verbandwechsel durch ambulante Pflegedienste, mit nicht besonders spezialisierten Pflegekräften, ausschließlich in der Häuslichkeit der Betroffenen reduziert.
Für Patient:innen, mit großflächigen und tiefen Wunden, freiliegenden Knochen, Sehnen, Organen, sowie immunsupprimierenden Erkrankungen, birgt die Behandlung durch unzureichend qualifiziertes Personal, in einer hygienisch nicht kontrollierbaren häuslichen Umgebung ein erhöhtes Risiko für Wundheilungsstörungen und progrediente Infektionsverläufe bis hin zur Sepsis / SIRS.
Im April 2017 wurde in § 37 SGB V ein neuer Abs. 7 hinzugefügt, der die Versorgung, chronischer und schwer heilender Wunden außerhalb der Häuslichkeit möglich macht. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bekam den Auftrag, die Versorgung von schwer heilenden und chronischen Wunden in der Häusliche Krankenpflege-Richtlinie zu regeln. Im Dezember 2019 trat die G-BA-Richtlinie über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege in Kraft, dazu wurde die Leistungsposition 31a „Wundversorgung einer chronischen und schwer heilenden Wunde“ eingeführt. Im Januar 2022 folgte die Rahmenempfehlung (nach § 132a Abs 1 SGB V) zur Versorgung Häuslicher Krankenpflege, die in § 6 die Anforderungen an spezialisierten Leistungserbringern, zur Versorgung von schwer heilenden und chronischen Wunden innerhalb und außerhalb der Häuslichkeit regelt.
In seiner Pressemitteilung zur HKP-Richtlinie schreibt der G-BA, dass für die Versorgung von chronischen und schwer heilenden Wunden eine besondere pflegefachliche Kompetenz von sehr großer Bedeutung ist und durch einen spezialisierten Leistungserbringer mit dahingehend qualifizierten Pflegefachkräften erfolgen soll. Kann die Versorgung der chronischen und schwer heilenden Wunde aufgrund der Komplexität der Wundversorgung oder den Gegebenheiten in der Häuslichkeit voraussichtlich nicht im Haushalt der oder des Versicherten erfolgen, soll die Wundversorgung durch spezialisierte Einrichtungen außerhalb der Häuslichkeit erfolgen. [2]
Die Versorgung schwer heilender und chronischer Wunden durch einen spezialisierten Leistungserbringer verfolgt das Ziel, eine bedarfsgerechte, flächendeckende und gut erreichbare medizinische Versorgung sicherzustellen. Dies kann nur gelingen in einer engen Kooperation mit niedergelassen Chirurgen, insbesondere mit dem Schwerpunkt Gefäßchirurgie.
Die grundlegenden Strukturen für eine interdisziplinäre, ergänzende und vertrauensvolle Zusammenarbeit im ambulanten Versorgungssetting sind damit geschaffen.
Was wird für eine erfolgreiche Zusammenarbeit benötigt
1.Schneller Zugang zu Diagnostik
Zügige Diagnosestellung der wundbedingenden Erkrankung ist Grundvoraussetzung für jedwede Therapie und Versorgungsplanung.
2.Gemeinsame Entscheidungsfindung zu den leitlinienbasierten Therapiemaßnahmen unter Einbezug der pflegefachlichen Kompetenzen und Patientenpräferenzen
Wesentlicher Aspekt dieses Punktes ist die ärztliche Aufklärung zu Nutzen und Schaden einzelner Therapieoptionen als Grundlage für eine Therapieeinleitung und -umsetzung. Darüber hinaus bedarf es eines, mit den Patient:innen erarbeiteten Pflegeplans zur Verbesserung der Lebensqualität, Förderung der Selbständigkeit und Sicherung des Therapieerfolges. Die Verordnung notwendiger Arznei-, Heil- und Hilfsmittel erfolgt auf Grundlage von Leitlinienempfehlungen und pflegefachlicher Expertise. Die Auswahl von Verbandmitteln soll indikationsbezogen, zielorientiert und in angemessenen Verbrauchsmengen erfolgen.
3. Direkter Arztkontakt bei Komplikationen
Bei auftretenden Komplikationen soll innerhalb 24 Stunden ein Arztkontakt möglich sein.
4. Zeitnahe Evaluation eingeleiteter Maßnahmen
Anhand von Zielerreichungsparametern, wie beispielsweise:
- Verbesserung des ABI bei PAVK,
- Störungsfreier Wundheilungsverlauf,
- Entfernung von avitalem Gewebe und Detritus,
- Verkleinerung der Wundfläche,
- Reduktion von Schmerz,
- Reduktion von Risikofaktoren, wie Übergewicht, Raucherentwöhnung, Ernährungsumstellung, durch pflegefachliche Patientenedukation.
5. Debridement
Ist eine mechanische Wundreinigung nicht ausreichend, z. B. bei sichtbarem avitalem Gewebe, oder therapieresistenten Infektionen sollte zeitnah ein chirurgisches Debridement durchgeführt werden. Das Debridement beschreibt dabei eine radikale Abtragung bis in das gesunde Gewebe.
6. Zeitnahe Differentialdiagnostik
Kommt es nach sechs Wochen leitliniengerechter Behandlung nicht zu sichtbaren Verbesserungen der Wundheilung, oder der Grunderkrankung, sollten weitere differenzialdiagnostische Maßnahmen, z. B. histologische und/oder mikrobiologische Probeentnahmen erwogen werden.
7. Spezielle Interventionen
- Niederdruck Wundtherapie
- Plastisch chirurgische Deckung
- Hautersatzverfahren
- andere adjuvante Maßnahmen auf der Grundlage von Leitlinienempfehlungen aus dem AWMF Register
Diskussion
Die für eine spezialisierte Wundbehandlung benötigten Ressourcen sind stark kontextabhängig und variieren vor allem mit Blick auf die verschiedenen Risikoprofile der Patient:innen. Die Risikoprofile sind abhängig von der Kombination der bei den Patienten vorliegenden Risikofaktoren, welche die Wundheilung beeinflussen. (3)
Im Wundzentrum müssen Ressourcen für die hohe Qualifikation der Pflegefachpersonen, zur direkte Patientenversorgung, für Koordinationsleistungen, sowie ein hohes Maß an Hygienemanagement vorgehalten werden.
Zur direkten Patientenversorgung gehören unter anderem lokaltherapeutische Maßnahmen wie Wundreinigung, Wundabdeckung, dermatokurative- und protektive Maßnahmen, eine sichere Risikoerkennung, Kompetenz zur Patientenedukation, die Umsetzung konservativer kausaltherapeutischer Maßnahmen, wie z. B. Kompressionstherapie und die Evaluationskompetenz zum Therapieverlauf sowie eingesetzte Hilfsmittel und adjuvante Maßnahmen.
Je nach Risikoprofil unterscheidet sich die Intensität der einzusetzenden Ressourcen. [3] Dem muss bei der Quantifizierung von ärztlichen und pflegerischen Vergütungssätzen Rechnung getragen werden. Im ambulanten Honorarsystem der Ärzte ist die Wundbehandlung einzelverrichtungsbezogen angelegt und als Mischkalkulation bewertet. Die Verschiedenartigkeit der Risiken wird hierdurch aktuell noch zu wenig berücksichtigt.
Gute Zusammenarbeit zwischen Wundzentren und Chirurg:innen bedeutet gemeinsame Versorgungsziele in einem interprofessionellen Versorgungsverbund umzusetzen.
Literatur
[1] Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e. V. (DGfW) (Hrsg.) (2023). Lokaltherapie schwerheilender und/oder chronischer Wunden aufgrund von peripherer arterieller Verschlusskrankheit, Diabetes mellitus oder chronisch venöser Insuffizienz. Version 2.2. Stand 31.10.2023. AWMF-Register-Nr.: 091-001
[2] https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/804/
[3] Laag, et. al., Die Zeit schürt alle Wunden, G+S 6/2018, DOI: 10.5771/1611-5821-2018-6-52

Falk Goedecke
Leiter spezialisierte pflegerische Wundbehandlung und Wissenschaft
WZ-WundZentren GmbH
Chirurgie
Goedecke F: Was benötigen spezialisierte Leistungserbringer zur Behandlung schwerheilender und chronischer Wunden von Chirurg:innen für eine gute Zusammenarbeit. Passion Chirurgie. 2025 Mai; 15(05): Artikel 03_02.
Mehr Artikel zum Thema „Wundversorgung“ finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Fachgebiete | Fachübergreifend.
Weitere aktuelle Artikel
10.02.2026 BDC|News
Neue Ausgabe der Passion Chirurgie: Perioperatives Management
erioperatives Management steht im Fokus der Januar/Februar-Ausgabe. Drei Fachbeiträge beleuchten das Thema – von den zehn wichtigsten Maßnahmen im perioperativen Management, über den idealisierten Workflow im Zentral-OP bis hin zur Prähabilitation zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Umsetzung. Viel Spaß beim Lesen!
20.01.2026 Fachübergreifend
Prähabilitation – vom theoretischen Ideal zur praktischen Umsetzung
Lange wurde dem Allgemeinzustand von Patient:innen vor onkologischen Eingriffen wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es galt die Devise, den Tumor so rasch wie möglich nach Diagnosestellung zu entfernen.
20.01.2026 Fachübergreifend
Prozessmanagement – Der idealisierte WorKFlow in einem Zentral-OP
Der idealisierte Workflow im Zentral-OP ergibt sich aus einer hochgradig standardisierten und zunehmend digital orchestrierten Prozesslandschaft.
20.01.2026 Fachübergreifend
Perioperatives Management – das sind die 10 wichtigsten Maßnahmen
In der modernen Chirurgie spielen viele Maßnahmen bezüglich eines adäquaten prä-, intra- und postoperativen Managements eine relevante Rolle, um die Krankenhausverweildauer sowie die Morbidität und Mortalität der Patient:innen zu reduzieren.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.