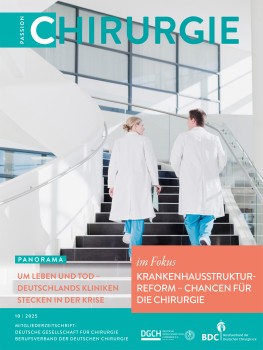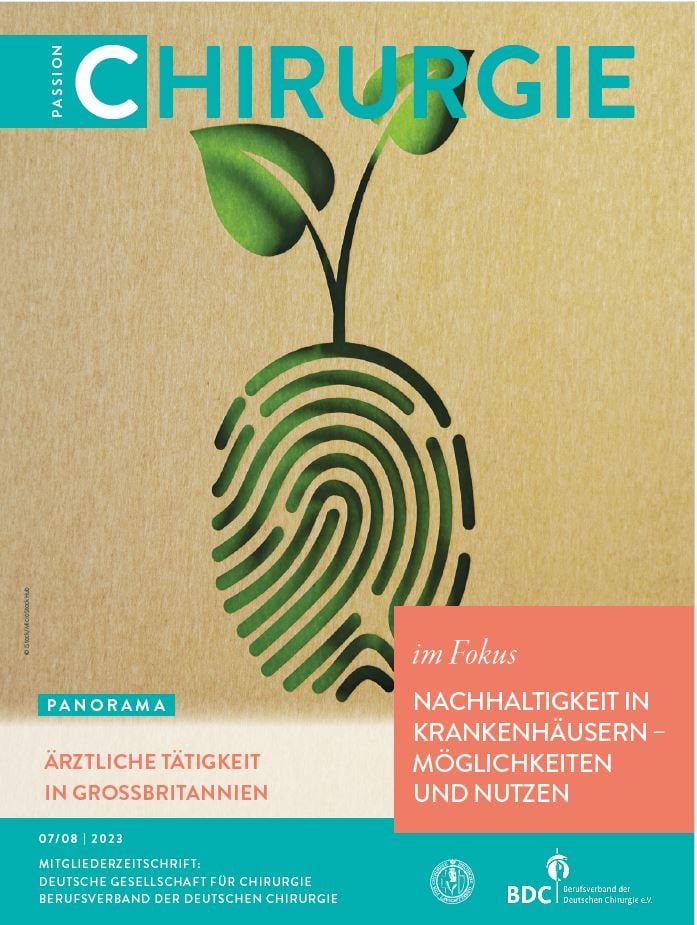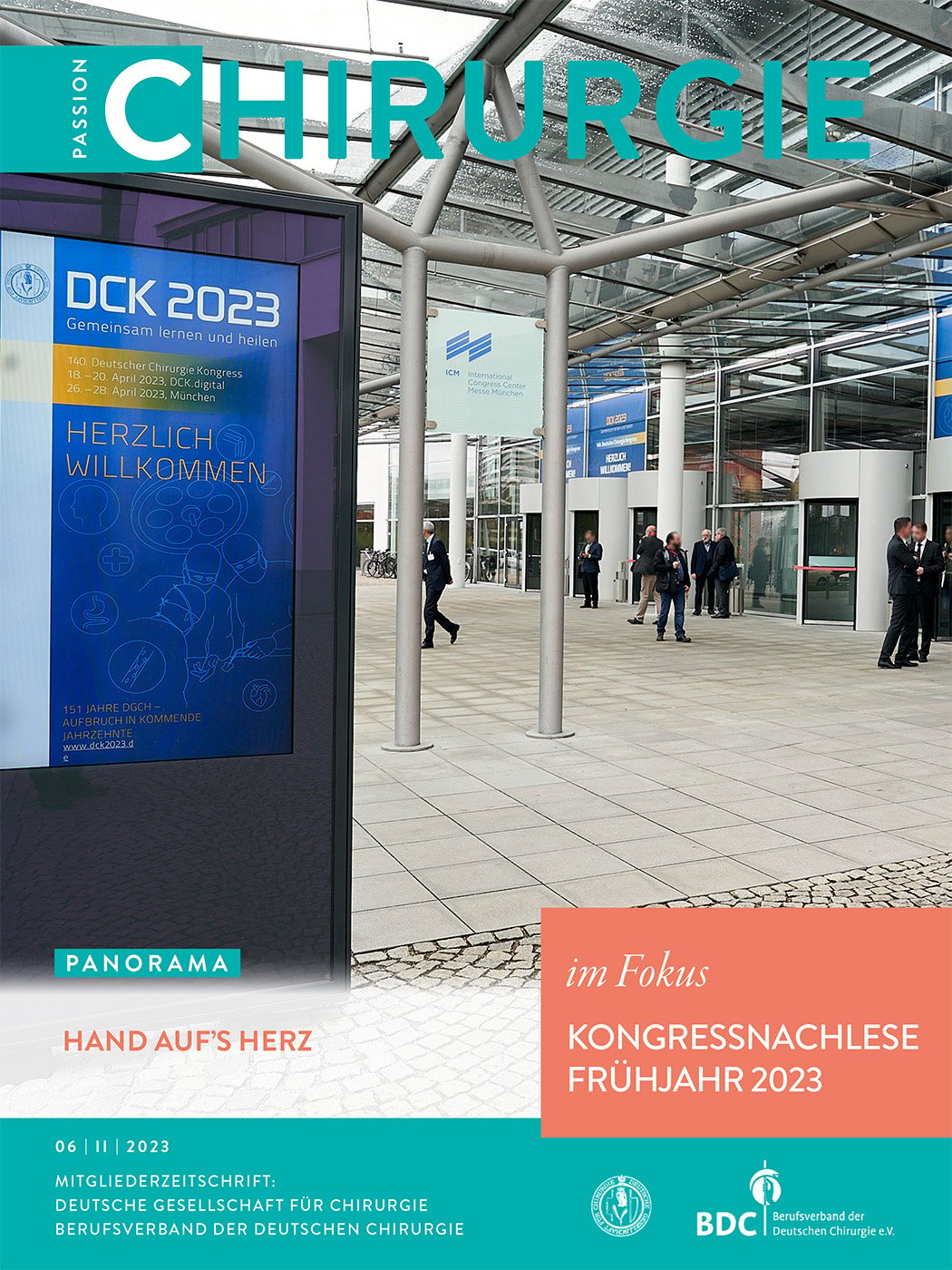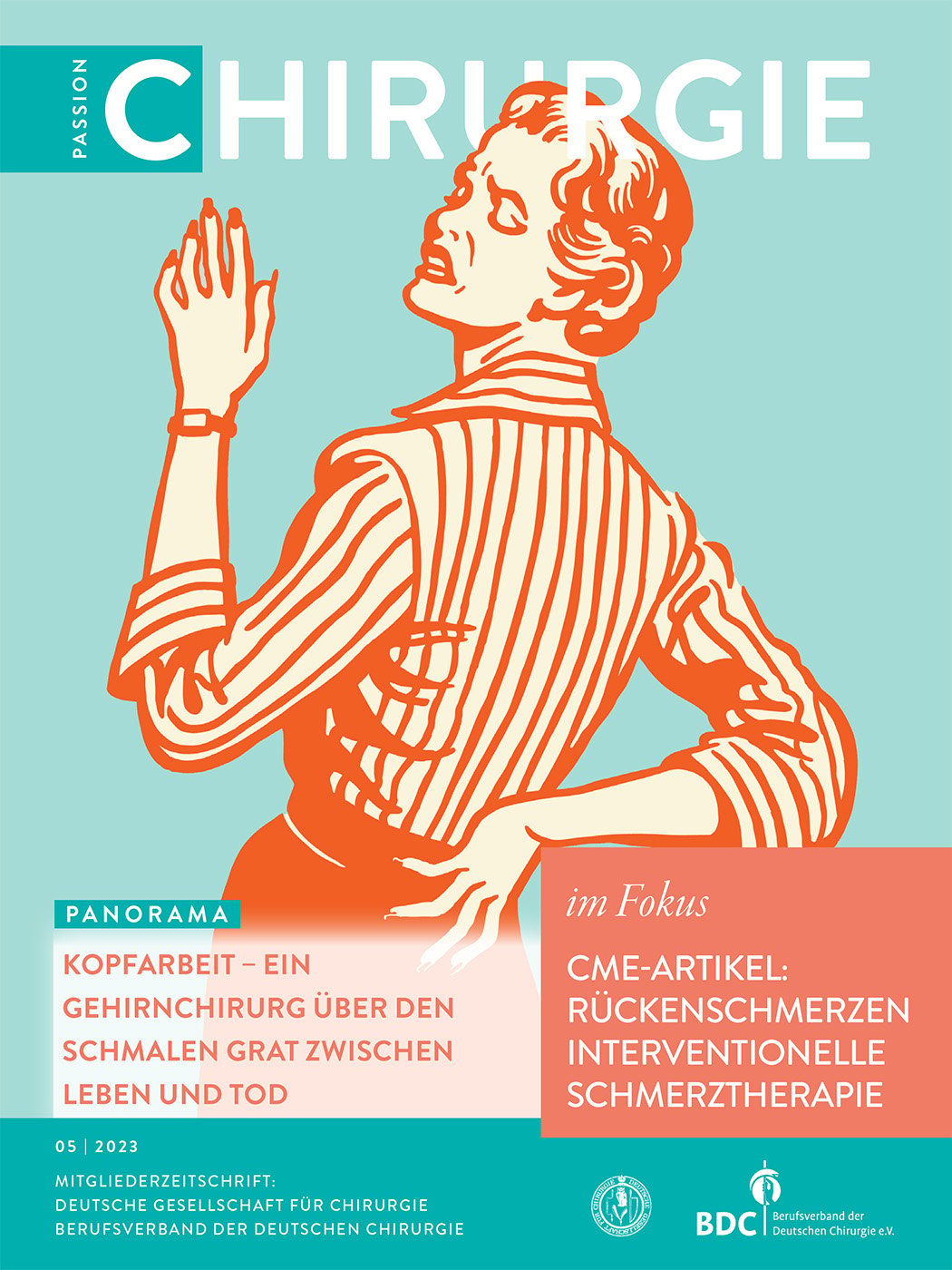20.09.2025 Arbeitsbedingungen
Um Leben und Tod – Deutschlands Kliniken stecken in der Krise

Dieser Artikel stammt aus DER SPIEGEL Nr. 32/5.8.2023. Er galt unter den Einsendungen für den BDC-Journalistenpreis 2024 als einer der Favoriten. Zum Schwerpunktthema „Krankenhausreform“ passt dieser Artikel, auch wenn er schon etwas älter ist.
Deutschlands Kliniken stecken tief in der Krise. Patienten werden teilweise schlecht versorgt, Tausende könnten gerettet werden, Manager fahren Verluste ein. Eine große Reform soll es nun richten – das Beispiel eines mittelgroßen Hauses zeigt, was das für die Menschen bedeuten kann.
Der Himmel ist blau an diesem schicksalhaften Morgen des 12. September 2022. Um kurz vor zehn Uhr laufen Frauen und Männer in weißem Kittel durch das Krankenhaus von Spremberg im Süden Brandenburgs. Es sind Chefärzte, die gleich in einem Konferenzraum die Wahrheit hören werden: Ihre Klinik ist insolvent. Zahlungsunfähig. Pleite.
Angereist sind ein Rechtsanwalt mit Assistentin, zwei Unternehmensberater, zwei Vertreter einer Krisenkommunikationsfirma. Die Sitzung dauert fast zwei Stunden. Als die Ärzte den Raum verlassen, schweigen sie. Mittlerweile ist der Insolvenzantrag beim Amtsgericht Cottbus gestellt. Der Beratertross, der nun das Sagen hat, hatte am Morgen den Besprechungsraum im Leitungsflur bezogen. Er befindet sich im Erdgeschoss des Krankenhauses mit mehr als 200 Betten, 34 Ärzten und 125 Pflegekräften. Die Krisenmanager finden tote Fliegen in Wassergläsern, WLAN gibt es nicht.
Der SPIEGEL konnte über Monate hinweg im Krankenhaus Spremberg recherchieren und die Klinik in ihrem Überlebenskampf begleiten. Was dort passiert ist, könnte so ähnlich bald in Hunderten der mehr als 1.800 Krankenhäuser in Deutschland geschehen. Laut einer Umfrage der Beratungsgesellschaft Roland Berger schreibt etwa die Hälfte der deutschen Hospitäler rote Zahlen.
Die Branche klagt über explodierende Kosten für Lohnerhöhungen und Energie bei bestenfalls stagnierenden Erlösen. Etwa jedes fünfte Krankenhaus werde in den kommenden zehn Jahren verschwinden, warnt Gerald Gaß, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Der Bundesgesundheitsminister sieht das entspannt. Deutschland hat viele Kliniken und gibt noch mehr für sie aus, bei allenfalls mittelprächtigen Ergebnissen für Patientinnen und Patienten. SPD-Mann Karl Lauterbach will deshalb einen Umbau des Systems. Kliniken wie die in Spremberg könnten zu den Opfern gehören.

Abb. 1: Krankenhausbetten pro 1.000 Einwohner im europäischen Vergleich 2021
Im Krankenhaus leitet Anwalt Mark Boddenberg vom ersten Tag an das Verfahren. Eine seiner Mitarbeiterinnen hat einen Drucker mitgebracht und sicherheitshalber auch Kopierpapier. »Man weiß nie, was man vorfindet«, sagt sie. Boddenberg verhandelt am Handy mit der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Zu Beginn der Mitarbeiterversammlung um 13.27 Uhr ist es mucksmäuschenstill in der Kantine des Krankenhauses, nur die Tiefkühltruhe brummt. Es sind so viele Ärzte, Krankenschwestern und andere Angestellte gekommen, dass etliche von ihnen stehen müssen. »Endlich dürfen wir mal wieder das Licht hier anmachen«, sagt eine Angestellte, die in der Kantine arbeitet. Bisher habe man darauf geachtet, die Beleuchtung im Speisesaal auszulassen – Sparmaßnahme von oben. Die Geschäftsführerin hat ihre Rede mit der Hand in einen Collegeblock geschrieben. Man stehe vor einer ökonomischen Klippe, windet sie sich. Nach ihr sprechen zwei drahtige Unternehmensberater. Sie bemühen sich um Mitgefühl, machen »das System« und »die Politik« verantwortlich. Einer der beiden hat mal als Arzt in der Gynäkologie des Klinikums rechts der Isar in München gearbeitet. Nun erzählt er etwas von der Ambulantisierung des Gesundheitswesens und »einem massiven Fallzahlrückgang«.
Die Krankenhausfinanzierung ist eine Dauerbaustelle, an der Regierungen und Kassen permanent herumwerkeln. Die letzte größere Reform fand vor 20 Jahren statt, die Gesundheitsministerin hieß damals Ulla Schmidt (SPD), Karl Lauterbach gehörte zu ihren engsten Beratern. Die beiden setzten damals jene »Fallpauschalen« durch, die Lauterbach heute als Ursache vieler Fehlentwicklungen betrachtet. In diesem System hat, vereinfacht gesagt, jedes Krankheitsbild ein Preisschild. Kliniken können anhand eines dicken Katalogs von Basisfallwerten, Multiplikatoren, Zusatzentgelten, Zu- und Abschlägen vorab ausrechnen, ob sie beispielsweise 2000 bis 4000 Euro für eine Blinddarmoperation von den gesetzlichen Krankenkassen bekommen – oder auch rund 10.000 für eine Harnblasenoperation bei einem Krebskranken. Das System führt dazu, dass es aus Sicht der Kliniken lukrative und wenig lukrative Patientinnen und Patienten gibt. Lukrativ ist, wer eine Krankheit mitbringt, die laut Katalog besonders gut bezahlt wird, keine Komplikationen erwarten lässt und das Klinikbett nicht lange blockiert. Krankenhäuser, die zu wenige solcher Idealpatienten auftreiben und durchschleusen können, geraten leicht in eine Schieflage.
Das Gutachten über die Zukunftsaussichten der Klinik in Spremberg ist 103 Seiten lang. Es stammt von der Münchner Firma WMC Healthcare, einem Beratungsunternehmen für Kliniken, das Krankenhaus hat es in Auftrag gegeben. Liest man es, könnte man kurz zusammengefasst sagen: Kein Mensch braucht dieses Krankenhaus. Die Berater formulieren das etwas differenzierter. Die Klinik besteht zu dem Zeitpunkt aus einem stationären Teil, drei Tageskliniken für Psychiatrie und Psychotherapie sowie einem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ), einer Art Poliklinik angestellter Ärztinnen und Ärzte, die ambulant behandeln. 2019 machte das Krankenhaus rund 24 Millionen Euro Umsatz, 2021 waren es nur noch 23 Millionen. 2021 wurden auch die Probleme sichtbar, ein negatives Betriebsergebnis von mehr als 1,9 Millionen Euro. Das Krankenhaus, seit 1869 an diesem Standort, litt zuletzt durch Corona vor allem an einer schlechten Auslastung der Psychiatrie. Dort waren die Fallzahlen um acht Prozent zurückgegangen. Obwohl weniger Patienten dort waren, musste das Krankenhaus Personal aufstocken, um 18 Stellen in zwei Jahren. Gesetzliche Vorgaben machten das nötig. Ein Arzt verdient in Spremberg im Schnitt 125.000 Euro im Jahr – etwas weniger als im bundesdeutschen Durchschnitt, der bei 129.000 Euro liegt. Trotzdem sank die Produktivität des Krankenhauses, weil mehr Personal weniger Patienten behandelte. 2021 lagen die Personalkosten bei 18,1 Millionen Euro. Spremberg rekrutiert 56 Prozent seiner Patienten aus einem Umkreis von zehn Kilometern, so die Analyse der WMC-Berater. Im Umkreis von 30 Fahrminuten finden sich gleich vier Konkurrenten, darunter ein Maximalversorger in Cottbus. Würde Spremberg von der Krankenhauslandkarte verschwinden, würde sich für die Bevölkerung der Region die durchschnittliche Fahrzeit zum nächsten Krankenhaus der Grundversorgung um knapp fünf Minuten erhöhen, haben die Berater ausgerechnet – von 8,6 auf dann 13 Minuten. Allerdings wären nur zwei Prozent der Klinikpatienten von einer längeren Fahrzeit betroffen. Soll man ein Krankenhaus retten, weil zwei Prozent der Patienten sonst etwas länger bis in ein anderes Klinikum brauchen?
Vor vielen deutschen Kliniken versammeln sich Mitte Juni Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte und Verwaltungsangestellte, sie halten Plakate hoch, auf denen »Alarmstufe Rot« steht. Sie verlangen Reformen, mehr Personal und vor allem: mehr Geld für die Kliniken. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten schon vor Monaten angekündigt, die Krankenhausfinanzierung umkrempeln zu wollen. Doch über Details wird gestritten. In Krankenhäusern, denen das Geld auszugehen droht, wachsen Existenzängste. »Es wäre unverantwortlich, Kliniken zu schließen, die für eine flächendeckende, wohnortnahe und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung gebraucht werden«, sagt die Ver.di-Gewerkschafterin Sylvia Bühler auf der zentralen Protestveranstaltung in Berlin.
Spremberg hat keinen wirklichen medizinischen Schwerpunkt. Es ist ein Krankenhaus, das alles Grundlegende macht, nichts aber mit besonderem Profil. Tendenziell, so die Analyse von WMC, werde die Zahl der Patienten weiter sinken. Steigen würden hingegen die Kosten. Personal, Energie, Material – mit drei bis vier Prozent jährlich kalkulieren die Berater. Kurz nach der Insolvenz wollen sie das Krankenhaus schrittweise schließen, nur eine Psychiatrie könnte bleiben. Die restliche Krankenversorgung soll ein MVZ übernehmen, das mit angestellten Ärzten die ambulante Versorgung übernimmt. Nur 15 Prozent der derzeitigen Fälle könnten künftig weiter am Standort behandelt werden. Spremberg steht nicht allein da mit seinen Problemen. Kleine Krankenhäuser, also jene mit weniger als 300 Betten, erwirtschafteten schon 2020 in 44 Prozent der Fälle ein Minus. Große Krankenhäuser mit mehr als 600 Betten standen noch schlechter da; mehr als die Hälfte schrieb rote Zahlen. Am besten ging es jenen Häusern, die mittelgroß sind, also zwischen 300 und 600 Betten haben – 57 Prozent von ihnen machten Gewinn. Spremberg ist das, was Berater als »subkritische Größe« bezeichnen.
Bei einem Treffen in Berlin können sich die Gesundheitsminister Ende Juni immer noch nicht auf ein gemeinsames Konzept einigen. Allerdings zeichnet sich ab, dass die ungeliebten Fallpauschalen gekappt werden. Sie sollen künftig nur noch bis zu 40 Prozent der Behandlungskosten decken. Der Löwenanteil von 60 Prozent soll in Zukunft über »Vorhaltepauschalen « finanziert werden. Das heißt: Die Kliniken bekommen Geld von den Krankenkassen künftig dafür, dass sie Betten, Personal und Material für die Behandlung bestimmter Krankheiten bereitstellen – auch wenn die Kapazitäten nicht komplett genutzt werden. Das soll den Konkurrenzkampf um Patienten mit lukrativen Krankheitsbildern mildern. Es soll auch verhindern, dass Hilfesuchende aus ökonomischen Gründen auch dann von Kliniken aufgenommen werden, wenn es gar nicht unbedingt nötig wäre – oder dass Kranke dort operiert werden, obwohl sie in einer besser ausgestatteten Klinik viel größere Heilungschancen hätten. Als Reformvorbild wird ein Modell aus Nordrhein-Westfalen gehandelt. Danach sollen etwa 70 medizinische »Leistungsgruppen« benannt und den Kliniken zugeordnet werden. Eine Leistungsgruppe wäre etwa Allgemeine Chirurgie, eine andere Kardiologie oder Intensivmedizin. Für jede Leistungsgruppe, die sie anbieten, müssen die Kliniken dann strikte Qualitätsstandards einhalten, etwa eine vorgegebene Zahl an Fachärzten und eine Mindestzahl an Behandlungen oder Operationen in dem jeweiligen Fachgebiet. Eine Klinik, die diese Standards reißt, soll für Behandlungen in dieser Leistungsgruppe kein Geld mehr von den Krankenkassen bekommen.
“Spremberg hätte nicht in Schieflage geraten müssen.“
Tobias Grundmann, Klinikchef
Krankenhausmanager Tobias Grundmann steht im Frühjahr 2023 vor dem Krankenhaus Spremberg und zeigt auf die Fassade. Grundmann ist der neue Geschäftsführer, er hat seine Vorgängerin im Dezember 2022 abgelöst. Zuvor leitete er für einen großen Krankenhauskonzern eine Klinik in Rottweil, südwestlich von Stuttgart. Er stammt aus Chemnitz und wollte wieder näher an seiner Heimat sein. Ein paar Wochen vorher hatte Grundmann eine Runde aus Klinikführungskräften in den Konferenzraum geladen, in dem zuvor das vorläufige Ende des Krankenhauses besiegelt worden war. Seitdem ist einiges passiert. Die Stadt sprang als neue Mehrheitsgesellschafterin bei und gab ein Darlehen von bis zu 3,75 Millionen Euro. Das todgeweihte Krankenhaus soll, entgegen dem Rat der Berater, gerettet werden. Grundmann hält nicht viel von den Konzepten seiner Vorgängerin, die etwa aufs Lichtausschalten setzte. Er investiert. Die Station neben dem Operationstrakt soll umgebaut werden. Patientenzimmer werden zurückgebaut, Duschen rausgestemmt, Patientenschränke entfernt. Rund 100.000 Euro soll das kosten. Grundmann erklärt seiner Leitungsrunde, dass das Krankenhaus kleiner werden muss. Wo einst Patienten stationär aufgenommen worden sind, sollen sie nun ambulant operiert werden. Deshalb brauche man die Station so nicht mehr, vielmehr sollten dort bald Untersuchungen vor Operationen und die anschließende Aufnahme stattfinden. Das Personal könne flexibel hin- und hergeschickt werden. Das bringt Geld, denn die Untersuchungen können über ein Pflegebudget gesondert mit den Krankenkassen abgerechnet werden. Grundmann führt die Runde durchs Haus. Der OP-Trakt ist gut zehn Jahre alt. Die Überwachungsstation ist lichtdurchflutet, hat sechs Betten und mit zwei Pflegekräften einen besseren Betreuungsschlüssel als so manche Universitätsklinik. Es ist Nachmittag, zwei Betten werden über den Flur geschoben. Die beiden älteren Patientinnen sind nach ihren Operationen noch intubiert, werden unterstützend beatmet. Schwere intensivmedizinische Fälle können in Spremberg nicht behandelt werden. Sie müssen nach Cottbus gebracht werden – 30 Minuten Fahrzeit entfernt. In der Notaufnahme ist nichts los an diesem Tag. Grundmann steuert einen Raum am Ende des Flurs an. Noch steht darin eine Liege, bald sollen es drei Betten sein. »Wir richten hier eine Überwachungsstation ein.« Wenn die Patienten dort liegen, können sie der stationären Pflege zugeschlagen und über das Pflegebudget der Kassen abgerechnet werden. Auch das bringe Geld. Grundmann ist sich sicher: Spremberg hätte nicht in Schieflage geraten müssen. Schuld sei zu einem großen Teil das Krankenhaus selbst gewesen, das die Feinheiten des Abrechnungssystems nicht gut genug genutzt habe.
Um den Druck für eine Reform zu erhöhen, stellt Karl Lauterbach im Juni eine Analyse von Experten vor, es ist ein vernichtendes Urteil über die Qualität der deutschen Klinikstruktur. In keinem europäischen Land gebe es mehr Krankenhausbetten pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner, und mit Ausnahme der Schweiz stecke auch kein europäisches Land gemessen am Bruttoinlandsprodukt mehr Geld ins Gesundheitssystem als Deutschland. Doch bei der Behandlungsqualität liege die Bundesrepublik im internationalen Vergleich nur im Mittelfeld. Der Grund: Viel zu viele Kranke würden in Kliniken behandelt, die dafür nur unzureichend qualifiziert seien. Patientinnen mit Brustkrebs hätten beispielsweise eine fast 25 Prozent höhere Überlebenschance, wenn sie in einem zertifizierten Brustkrebszentrum behandelt würden statt in einem Wald-und-Wiesen-Hospital. Und würden Menschen mit Schlaganfällen durchweg in Kliniken mit spezieller Behandlungseinheit (Stroke-Unit) gebracht, könnten rund 5000 Todesfälle im Jahr nach dem Gehirninfarkt vermieden werden, so die Experten. Zehntausende Menschenleben, mahnt Lauterbach, könnten jedes Jahr gerettet werden, wenn anspruchsvolle Behandlungen nur noch in Kliniken vorgenommen werden, die über große Routine und Kompetenz verfügten. Kleinere Krankenhäuser sollten sich auf die Grundversorgung und einfache Standardbehandlungen konzentrieren – oder sich in ambulante Behandlungszentren mit Haus und Fachärzten umwandeln. Die gesetzlichen Krankenkassen assistieren. Sie halten 1.250 Kliniken in Deutschland für ausreichend, um die Bevölkerung zu versorgen. Das wäre gut ein Viertel weniger als bisher.
An einem Freitagmorgen im Mai dieses Jahres grillt Geschäftsführer Grundmann für seine Leute. Neben der Notaufnahme des Krankenhauses ist dazu ein Pavillon aufgebaut worden. Grundmann stellt die neu ernannte Pflegedienstleiterin vor, während er leicht verkohlte Würste auf dem Grill wendet. Etwa 100 Meter neben Grundmanns Grillfest führt Sabine Manka durch ihr Reich. Manka hat seit ihrer Ausbildungszeit beruflich nie etwas anderes kennengelernt als das Krankenhaus Spremberg. Sie ist sogar im Krankenhaus auf die Welt gekommen. Seit 1987 arbeitet sie in Spremberg. Manka ist Chefärztin der Gynäkologie. Als sie kam, wurden noch 500 Kinder pro Jahr in Spremberg geboren, in den besten Zeiten waren es mal 700. Kurz vor der Abwicklung der Geburtshilfe waren es nicht mal mehr 50. Schwangere müssen nun zur Entbindung nach Senftenberg, Forst oder Cottbus fahren. Manka hat sich auf Brustkrebsoperationen spezialisiert. Rund 100 Frauen operiert sie pro Jahr. Das ist künftig wohl die Mindestmenge, die ein Krankenhausstandort jährlich erbringen muss, um Brustkrebspatientinnen auf Kosten der Kassen behandeln zu dürfen. Spremberg ist nicht von der Deutschen Krebsgesellschaft als Brustkrebszentrum zertifiziert. In Fachkreisen würde man vermutlich abraten, eine so schwerwiegende Erkrankung in einer schrumpfenden Klinik einer brandenburgischen Kleinstadt behandeln zu lassen. Andererseits ist Manka durch ihre Spezialisierung sehr erfahren. In einem großen Klinikum kann die Gesamtzahl der behandelten Fälle größer sein, aber auf den einzelnen Operateur kommen am Ende eventuell weniger Patienten. Manka sagt, dass aus medizinischer Sicht wenig dagegenspreche, Tumore der Brust auch ambulant zu entfernen – was hier bisher kein medizinischer Standard ist. »Brustoperationen sind oft Operationen an der Oberfläche. Man kann eine Drainage einsetzen und die Frau danach nach Hause schicken.« Ambulante Versorgung soll die Zukunft sein in Spremberg. Spezialistin Manka muss jetzt Sprechstunden abhalten, zu ihr kommen nun auch Frauen für Routineuntersuchungen. »Ich musste mich erst mal damit beschäftigen, wie man einen Krebsfrüherkennungsabstrich macht«, sagt Manka. Zuletzt hatte sie damit vor Jahrzehnten während ihrer Facharztausbildung zu tun. Ob sie künftig noch Krebspatientinnen operieren kann? 2022 hatte sie 99 Brustoperationen, im ersten Halbjahr 2023 waren es 48. Die Mindestmengen für zertifizierte Zentren würde sie damit verfehlen, und das könnte, wenn die Reform kommt, zum Aus der Brustchirurgie in dem Haus führen. »Das würde uns die Füße weghauen«, sagt Manka. Was dann aus ihr wird? Unklar.
Mitte Juli verkünden die Gesundheitsminister von Bund und Ländern endlich eine Einigung, wenn auch mit einer Gegenstimme aus Bayern. Der Wechsel von den Fallpauschalen zu den Vorhaltevergütungen wird vereinbart, ebenso die Einführung der Leistungsgruppen. Lauterbach spricht euphorisch von einer »Revolution«. Viele Interessenvertreter sind skeptischer. Für die Reform müssten Abteilungen verschiedener Krankenhäuser verlagert, geschlossen oder zusammengelegt werden. Das kostet, doch die Minister können sich nicht auf zusätzliche Mittel zur Finanzierung der Reform einigen.
Christine Herntier ist eine Optimistin. Die parteilose Bürgermeisterin von Spremberg vertritt die Anteile der Stadt am Krankenhaus. Bei der vergangenen Wahl musste sie sich gegen den Kandidaten der AfD durchsetzen, gewann dann aber in einer Stichwahl mit komfortabler Mehrheit. Spremberg hat knapp 22.000 Einwohner. Zu DDR-Zeiten waren es mehr, auch wenn der Zuschnitt der Gemeinde ein anderer war als heute. Es boomten Tagebaue und Kohlekraftwerke, die für Arbeitsplätze und Wohnraum sorgten. Steht man auf dem Dach des Krankenhauses, sieht man die Kühltürme des Kraftwerks Schwarze Pumpe, heute ein Ortsteil von Spremberg. Noch husten sie weiße Dampfschwaden aus. Für die Bürger hänge jetzt alles am Kohlekompromiss, sagt Herntier. Sie steht in einem Patientenzimmer der Klinik, die Betten sind mit Folie abgedeckt. Es ist zwischenzeitlich ihr Haus geworden, die Stadt übernahm Anteile vom Förderverein und ist nun mit 80 Prozent Mehrheitsgesellschafterin. Seitdem muss Geschäftsführer Grundmann einmal im Monat Zahlen präsentieren, bei ihr im Rathaus. Das Krankenhaus, so Herntier, sei vielleicht medizinisch nicht absolut notwendig, aber als psychologisches Signal. »Es ist ein Pflänzchen Hoffnung. Wäre das Haus verschwunden, hätten sich viele Spremberger mit herunterziehen lassen«, glaubt sie. Dass Herntier dem Krankenhaus überhaupt beispringen konnte, liegt daran, dass die Gemeinde wirtschaftlich nicht so schlecht dasteht. Noch 2022 erwirtschaftete die Stadt knapp 5,7 Millionen Euro Überschuss, die Zahl der Gewerbebetriebe stieg sogar leicht auf 1622. Herntier setzt etwa auf eine australische Firma, die im Gewerbegebiet Vorprodukte für Batterien produziert, ein Windpark soll entstehen. Bis 2030 hofft man in Spremberg auf steigende Einwohnerzahlen. Dann könnte ein eigenes Krankenhaus ein wichtiger Standortfaktor sein – wenn es noch da ist.
Eine Kliniklandschaft, wie Karl Lauterbach sie sich vorstellt, wäre in ein Dreiklassensystem aufgeteilt. Ganz oben, Level 3, würden die großen Maximalversorger stehen, etwa Universitätskliniken mit vielen gut ausgestatteten Abteilungen. Zum Mittelfeld, Level 2, zählten spezialisierte Fachkliniken sowie Krankenhäuser, die neben einer Grundversorgung mit Chirurgie, Intensiv- und Notfallmedizin noch mindestens einen herausragenden Schwerpunkt anbieten können. Kliniken auf Level 1, die »Grundversorger«, sollten nur noch Basisbehandlungen in innerer Medizin und Chirurgie vornehmen. Manche dieser Kliniken sollten sich als Untergruppe Level 1i auf ambulante und kurzstationäre Behandlungen beschränken. Sie hätten keine Notaufnahme mehr und würden nicht mehr von Rettungswagen angefahren. Das wäre dann eine Art Ärztehaus mit Übernachtungsmöglichkeit, spotten Kritiker. Die Gesundheitsminister der Länder halten nicht viel von dieser Kategorisierung. Sie könne dazu führen, dass die Patienten nur noch in Level-3-Kliniken drängen würden, zulasten gut geführter kleinerer Häuser: »Am Ende werden die Leute einfach sagen, große Krankenhäuser sind gute Krankenhäuser«, sagt Karl-Josef Laumann (CDU), der Gesundheitsminister Nordrhein-Westfalens. »Dabei kann eine Lungenfachklinik in diesem Bereich mindestens genauso gut sein wie eine Universitätsklinik.« Der Kompromiss sieht nun vor, dass Unikliniken und große Krankenhäuser eine Koordinierungsfunktion bekommen sollen. Ähnlich wie in der Coronakrise sollen sie schwere Fälle an sich ziehen und weniger komplizierte an Kliniken mit niedrigeren Levels abgeben. Außerdem will Lauterbach eine »Transparenzoffensive« starten, ohne Beteiligung der Länder. In einem vom Bund initiierten Informationsportal sollen die Bürger nachschauen können, welche Kliniken wie oft bestimmte Eingriffe machen und wie viele Fachärzte sie dafür vorhalten. In diese Datenbank will Lauterbach auch seine Level-Einteilung einpflegen.
“Die Klinik ist vielleicht nicht medizinisch notwendig,
aber als psychologisches Signal.“
Christine Herntier, Bürgermeisterin
In der Notaufnahme des Klinikums Spremberg schieben an einem Freitagvormittag im Juni drei Pflegekräfte Dienst, eine junge Frau im Freiwilligen Sozialen Jahr und der Chefarzt der Abteilung. Ein Pfleger klebt rote Pappe auf eine Glastür, damit Besucherinnen und Besucher nicht mehr durchgucken können. Überfüllte Wartesäle, überlastete Ärzte oder abweisende Pflegekräfte gibt es nicht in Spremberg. Wartezeiten? »Manchmal gibt es die, aber es ist selten«, sagt Anne Grabein, 39, Krankenpflegerin in der Notaufnahme. Eine 90-Jährige hat Schmerzen an Arm und Schulter, wurde von Angehörigen gebracht. Gestürzt sei sie nicht, doch Arzt Robert Tscherner traut den Aussagen der Dame nicht ganz und schickt sie zum Röntgen. Eine eigene Röntgenabteilung gibt es in Spremberg nicht mehr, dafür eine radiologische Praxis direkt neben der Notaufnahme. Eine Mutter kommt mit ihrem Sohn in die Rettungsstelle. Er war in eine Schulhofschlägerei verwickelt, hat nun eine Wunde an der Lippe. Tscherner, ein Internist, holt einen Chirurgen hinzu, der soll entscheiden, ob man nähen muss. Um 12.29 Uhr klingelt dann das Telefon, Sekunden später geht Tscherners Piepser. Die Rettungsleitstelle hat Alarm ausgelöst. Ein Notruf aus einer Spremberger Grundschule ist eingegangen, ein Kind schaue apathisch. Tscherner muss auch Notarztdienst schieben, es ist der erste Einsatz heute. Es sind eher die alltäglichen Dramen, die in der Notaufnahme in Spremberg behandelt werden. Und es sind Fälle, für die es in einer ausgedünnten medizinischen Versorgungslandschaft mit wenigen niedergelassenen Ärzten kaum noch Ansprechpartner in der Nähe geben wird.
Auch nach der Einigung der Gesundheitsminister bleiben viele Fragen offen. Vor allem solche, bei denen es ums Geld geht. Lauterbach solle erst aufzeigen, wie die zu Gesundheitszentren abgestuften Kleinkliniken wirtschaftlich arbeiten können, fordern Vertreterinnen und Vertreter der Länder. Bis zum Ende des Sommers soll an Gesetzestexten gebastelt werden. »Bei uns stehen halt die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, und bei uns fliegen die Tomaten, wenn ein Klinikum fusioniert oder ein kleines Klinikum geschlossen wird«, sagt der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). Bis die Reform überall umgesetzt sei, dürften Jahre vergehen, räumt Lauterbach ein. Die Länder pochen darauf, dass die Krankenhausplanung, also die Grundsatzentscheidung über Standorte, in ihrer Hand bleiben soll. Die Entfernung zum nächsten Krankenhaus mit Notaufnahme dürfe in dünn besiedelten Regionen nicht mehr als 30 Autominuten betragen. »Auf dem Land wird sich sehr wahrscheinlich wenig ändern, da wir da schon oft eine Unterversorgung haben«, kündigt NRW-Minister Laumann schon mal an. »Die Doppelstrukturen haben wir vor allem in den Ballungsgebieten.«
Im Juli herrscht unerwartet Betrieb im ersten Stock des Krankenhauses Spremberg. Geschäftsführer Grundmann hat eingeladen, zur Eröffnung einer neuen Station. Bürgermeisterin Herntier ist gekommen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine Journalistin der »Lausitzer Rundschau«. Dann schreitet der Geschäftsführer zur Tat. Mit je einer Schere schneiden Grundmann und die Pflegedienstleiterin ein rotes Band durch, das an zwei Infusionsständern festgebunden ist. Grundmann weiß noch nicht genau, wie sich die Pläne der Gesundheitsminister auf seine Klinik auswirken werden. Letztlich, sagt er, werde wohl das Land Brandenburg entscheiden, welches Versorgungsniveau das Krankenhaus künftig erbringen könne. Mit der Auslastung der Klinik ist er einstweilen zufrieden. Ende Juni lag sie bei 78 Prozent, 65 Patienten seien in der Psychiatrie, 65 weitere in den anderen Abteilungen. Die neu eröffnete Aufnahmestation sieht ein wenig so aus, als hätte Grundmann Restbestände eines Billigmöbelhauses aufgekauft. Wahrscheinlich ist es mit der Station so, wie Herntier die Sache für das ganze Krankenhaus sieht. Besser billige Möbel als gar kein Haus mehr, wenn es darum geht, Zuversicht für den Ort zu demonstrieren.

Korrespondierender Autor:
Martin U. Müller
Redakteur
DER SPIEGEL

Matthias Bartsch
Redakteur
DER SPIEGEL
Panorama
Bartsch M, Müller MU: Um Leben und Tod – Deutschlands Kliniken stecken in der Krise. Passion Chirurgie. 2025 Oktober; 15(10): Artikel 09.
Mehr Panorama-Artikel finden Sie auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Wissen | Panorama.
Weitere aktuelle Artikel
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.