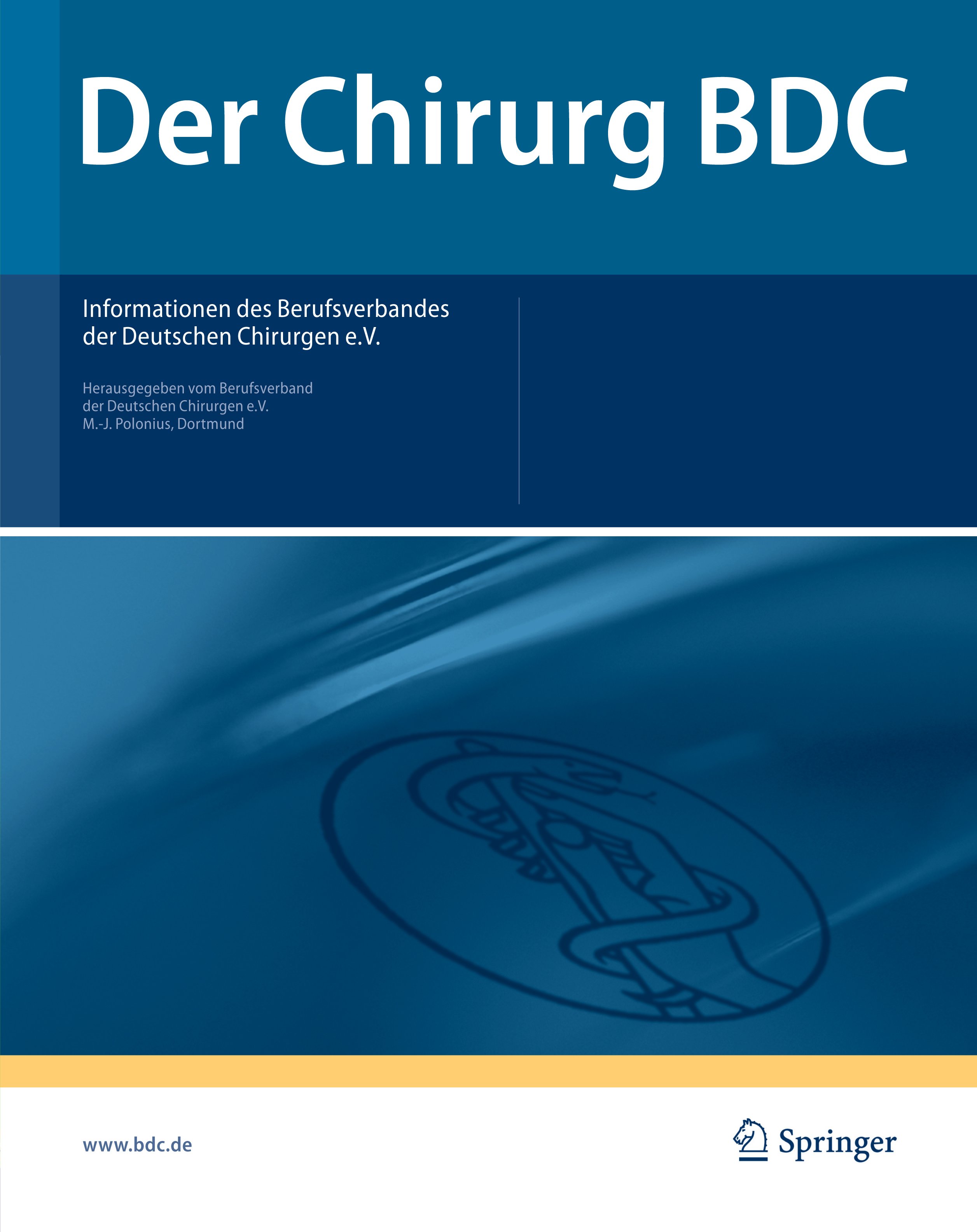01.11.2025 Fachübergreifend
Safety Clip: Patientenlagerung bei Operationen und Interventionen

„WIE MAN SICH BETTET, SO LIEGT MAN“ – VERANTWORTUNG UND SORGFALT IM OP
Das bekannte Sprichwort „Wie man sich bettet, so liegt man“ erhält im Kontext der operativen Medizin eine tiefere, fachliche Dimension. Während eines chirurgischen Eingriffs sind Patienten aufgrund der Narkose nicht in der Lage, ihre Körperposition selbst zu beeinflussen – die Verantwortung für eine fachgerechte Lagerung liegt somit vollständig beim medizinischen Personal. Eine korrekte Lagerung geht weit über die Frage des Komforts hinaus, denn sie ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Eingriffs und die Vermeidung von Komplikationen.
Rechtlicher Rahmen: Verantwortung und Beweislast
Die Patientenlagerung ist ein integraler Bestandteil des operativen Gesamtprozesses und fällt unter die Sorgfaltspflicht gemäß § 630a Abs. 2 BGB. Der Gesetzgeber verlangt, dass medizinische Maßnahmen dem sogenannten Facharztstandard entsprechen – also dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft und Technik.
Kommt es zu Lagerungsschäden, greift die Rechtsprechung auf das Prinzip des „objektiv beherrschbaren Risikos“ zurück. Das bedeutet: Lagerungsschäden gelten als vermeidbar, wenn die Klinik alle organisatorischen und technischen Maßnahmen getroffen hat, um sie zu verhindern. Im Schadensfall kehrt sich gegebenenfalls die Beweislast um – die Klinik muss nachweisen, dass sie den Facharztstandard eingehalten hat.
Ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH, VI ZR 529/16) bestätigt diese Sichtweise: Wenn ein Schaden durch eine fehlerhafte Lagerung entsteht, etwa durch eine leitfähige Unterlage bei Verwendung eines HF-Geräts, liegt die Beweispflicht bei der Klinik.
Bedeutung der Lagerung für den Operationserfolg
Die Lagerung des Patienten beeinflusst maßgeblich:
- den Zugang zum Operationsgebiet,
- die Sicht und Bewegungsfreiheit des Operateurs,
- die Sicherheit der Anästhesie, die Vermeidung von Druckstellen, Nervenschäden und anderen Lagerungsschäden.
Eine suboptimale Lagerung kann zu schwerwiegenden Komplikationen führen – von Hautläsionen über Muskelverspannungen bis hin zu irreversiblen Nervenschädigungen wie Paresen. Diese Schäden sind nicht nur medizinisch relevant, sondern auch haftungsrechtlich brisant.
Entwicklung und Standardisierung von Lagerungstechniken
Die Anforderungen an die Lagerung von Patienten haben sich mit der Spezialisierung der Operationstechniken stark weiterentwickelt. In allen operativen Fachbereichen (zum Beispiel in der Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Neurochirurgie) kommen heute differenzierte Lagerungstechniken zum Einsatz.
Moderne OP-Tische und Lagerungshilfsmittel ermöglichen eine präzise Positionierung. Dazu gehören zum Beispiel:
- Arm- und Beinausleger,
- Kopfschalen und Drei-Punkt-Schädel-Fixierer,
- Gelkissen,
- Kissen für die Bauchlage,
- Knierollen,
- Vakuummatratzen.
Elektronisch gesteuerte Positionierungssysteme
Hersteller von Medizintechnik, in diesem Fall von OP-Tisch-Systemen, bieten umfangreiche Dokumentationen und Bildmaterial zur Schulung und Standardisierung an. Im Rahmen der Übergabe an die Klinik ist eine sogenannte „Ersteingewiesenen-Schulung“ verpflichtend.
Ausbildung und Qualifikation des
OP-Personals
Fachkräfte mit einer Weiterbildung in der OP-Pflege oder einer Ausbildung zur Operationstechnischen Assistenz (OTA) erhalten grundlegende Kenntnisse zur Patientenlagerung bereits in ihrer Ausbildung. Die spezifischen Lagerungstechniken werden in den praktischen Phasen vertieft.
Wichtig ist, dass alle Mitarbeitenden im OP-Bereich regelmäßig geschult werden – insbesondere bei Einführung neuer Lagerungssysteme oder Änderungen der Lagerungsstandards. Workshops und praktische Übungen sind essenziell, um die Qualität und Sicherheit der Lagerung zu gewährleisten.
Die vier Phasen der Patientenlagerung
Die Patientenlagerung lässt sich in vier Phasen unterteilen:
1. Präoperative Phase
- Einschätzung von Risikofaktoren (zum Beispiel Adipositas, Diabetes, Polyneuropathie)
- Auswahl der geeigneten Lagerung
- Dokumentation bestehender Hautveränderungen
2. Lagerung zur Operation
- Durchführung durch das OP-Team
- Kontrolle durch den Operateur
- Einsatz von Lagerungshilfsmitteln
3. Intraoperative Lageveränderung
- Anpassung der Lagerung während des Eingriffs
- Kommunikation zwischen Anästhesie und OP-Team
- Dokumentation der Veränderungen
4. Postoperative Phase
- Rücklagerung des Patienten
- Kontrolle auf Lagerungsschäden
- Übergabe an die Pflege mit entsprechender Dokumentation
Dokumentation und Nachweisführung
Die Lagerung und eventuelle intraoperative Lageveränderungen müssen im OP-Protokoll dokumentiert werden. Dabei reichen oft Schlagworte aus, wenn die Standardlagerungen zentral in gelenkten und freigegebenen Dokumenten hinterlegt sind. Zusätzliches Zubehör, das zum Einsatz kam, sollte ergänzend dokumentiert werden.
Diese strukturierte Dokumentation dient nicht nur der Qualitätssicherung, sondern auch der rechtlichen Absicherung. Im Falle eines Lagerungsschadens kann so nachgewiesen werden, dass die Lagerung dem aktuellen Standard entsprach.
Prävention von Lagerungsschäden
Zur Vermeidung von Lagerungsschäden sind folgende Maßnahmen entscheidend:
- Risikoeinschätzung vor der OP
- Verwendung geeigneter Lagerungshilfsmittel
- Regelmäßige Schulungen und Workshops der Mitarbeitenden
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit an der OP-Schleuse, im OP-Saal, in der Anästhesie Ein- und Ausleitung
- Standardisierte Dokumentation der Lagerung im OP-Protokoll
- Technische Unterstützung durch moderne OP-Tischsysteme
Ein strukturierter Präventionsprozess – wie er etwa in der Dekubitusprävention etabliert ist – kann auch für Lagerungsschäden adaptiert werden. Dazu gehören präoperative Screenings, postoperative Hautkontrollen und die eventuelle Einbindung von Wundexperten.
Kommunikation mit dem Patienten
Auch wenn der Patient die Lagerung nicht selbst durchführen kann, sollte er über die geplante Lagerung informiert werden. Dies schafft Vertrauen und Transparenz. Besonders bei längeren Eingriffen oder bekannten Risikofaktoren kann eine präoperative Aufklärung über mögliche Lagerungskomplikationen sinnvoll sein.
Fallbeispiel: Lagerungsschaden durch Verbrennung
Ein Patient erlitt nach einer Prostataoperation schwere Verbrennungen an den Gesäßhälften. Die Ursache war eine leitfähige Unterlage in Kombination mit einem Hochfrequenzgerät. Der BGH entschied, dass dieses Risiko voll beherrschbar gewesen sei und die Klinik beweisen müsse, dass sie alle notwendigen Maßnahmen getroffen habe.
Fazit: Lagerung als Schlüssel zur Patientensicherheit
Die Patientenlagerung ist weit mehr als eine technische Notwendigkeit – sie ist ein zentraler Bestandteil der operativen Versorgung. Eine fachgerechte Lagerung trägt entscheidend zum Erfolg des Eingriffs bei und schützt den Patienten vor vermeidbaren Schäden.
Kliniken sind gut beraten, Lagerungsstandards zu definieren, regelmäßig zu schulen und die Durchführung sorgfältig zu dokumentieren. So kann nicht nur die Qualität der Versorgung gesteigert, sondern auch die rechtliche Sicherheit erhöht werden.
Denn: „Wie man sich bettet, so liegt man“ – und wie der Patient gebettet wird, liegt in der Verantwortung des OP-Teams.
Vonderhagen K: Safety Clip: Patientenlagerung bei Operationen und Interventionen. Passion Chirurgie. 2025 November; 15(11): Artikel 04_03.
Autor:in des Artikels
Weitere aktuelle Artikel
01.10.2011 Fachübergreifend
IT-gestütztes Teamlernen in der Chirurgie – der Weg vom kurzfristigen ‘Change’ zum dauerhaften ‘Improve’
Aktuelle Herausforderungen Die wirtschaftliche Lage vieler Kliniken wird von der
01.10.2011 Fachübergreifend
Wer weiß wann was? Informationslogistik als Grundlage dynamischer Abläufe
Prozessmanagement im Krankenhaus ist nicht erst seit Einführung der DRGs
01.09.2010 Allgemeinchirurgie
Editorial: Adipositaschirurgie ist keine Lifestyle-Medizin
Die chirurgische Therapie der Adipositas erfährt zunehmend auch in Deutschland
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.