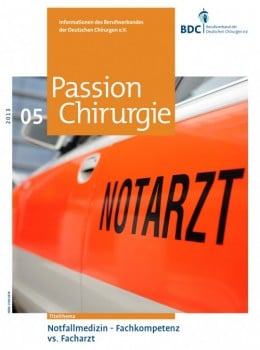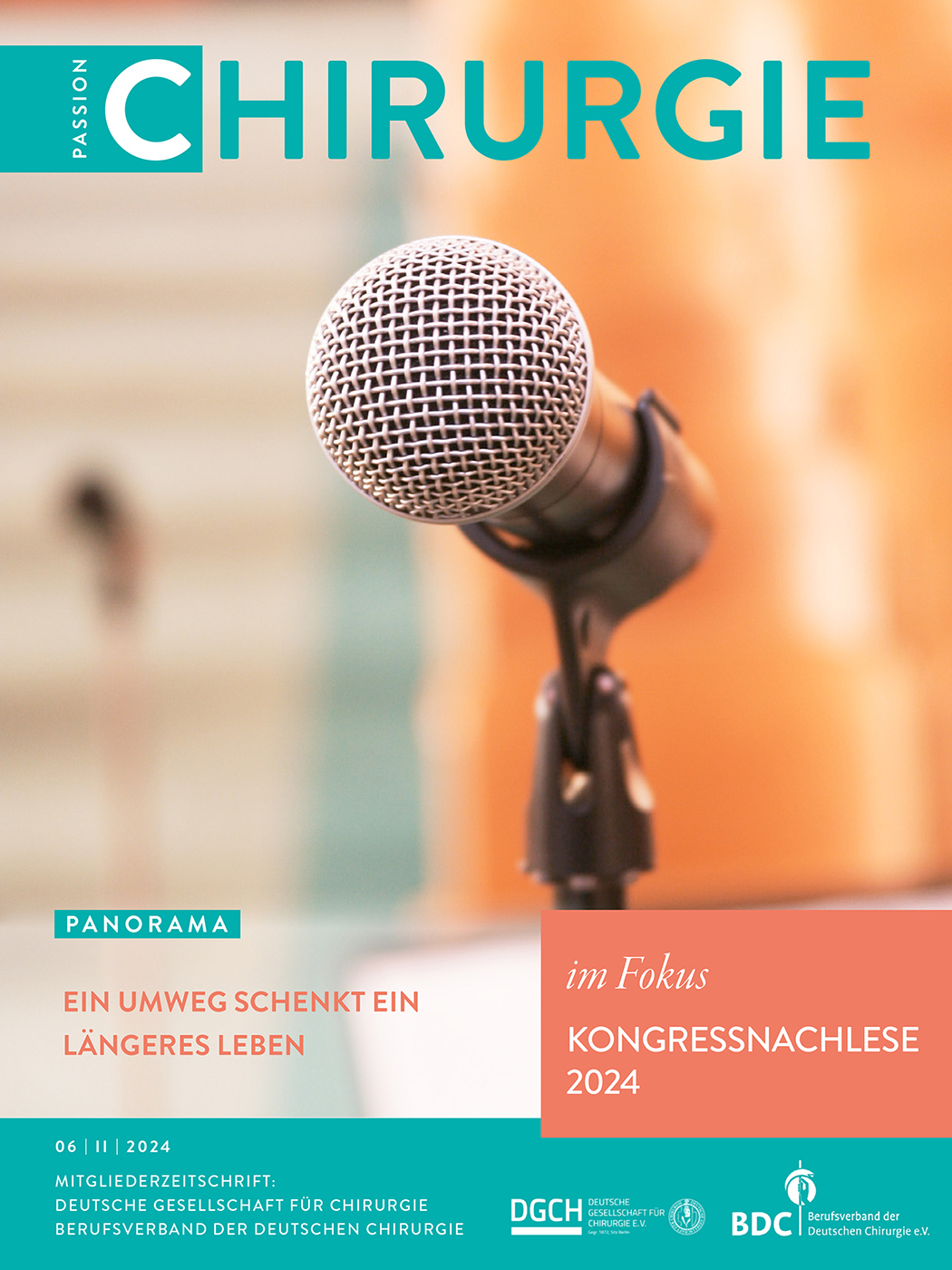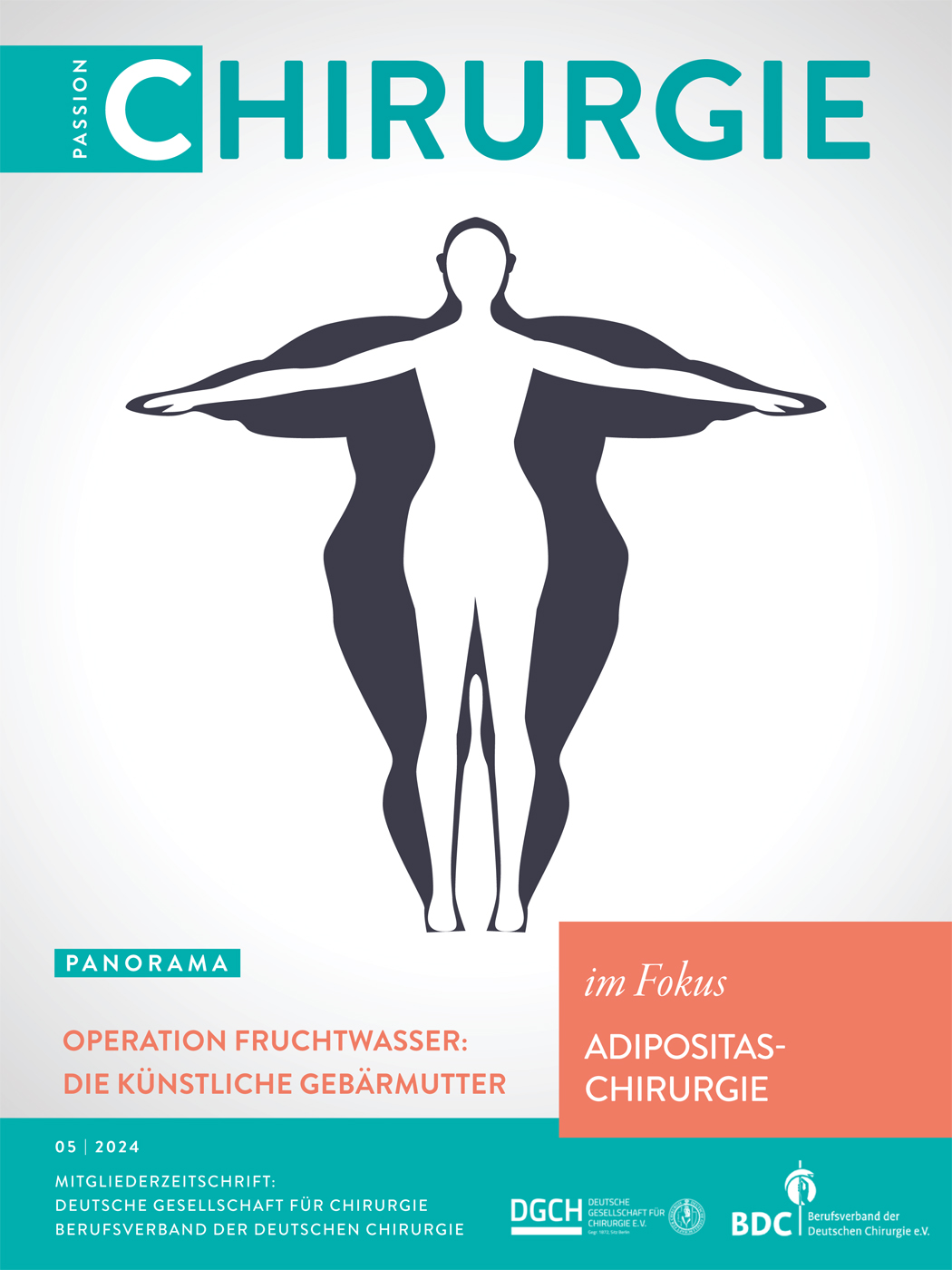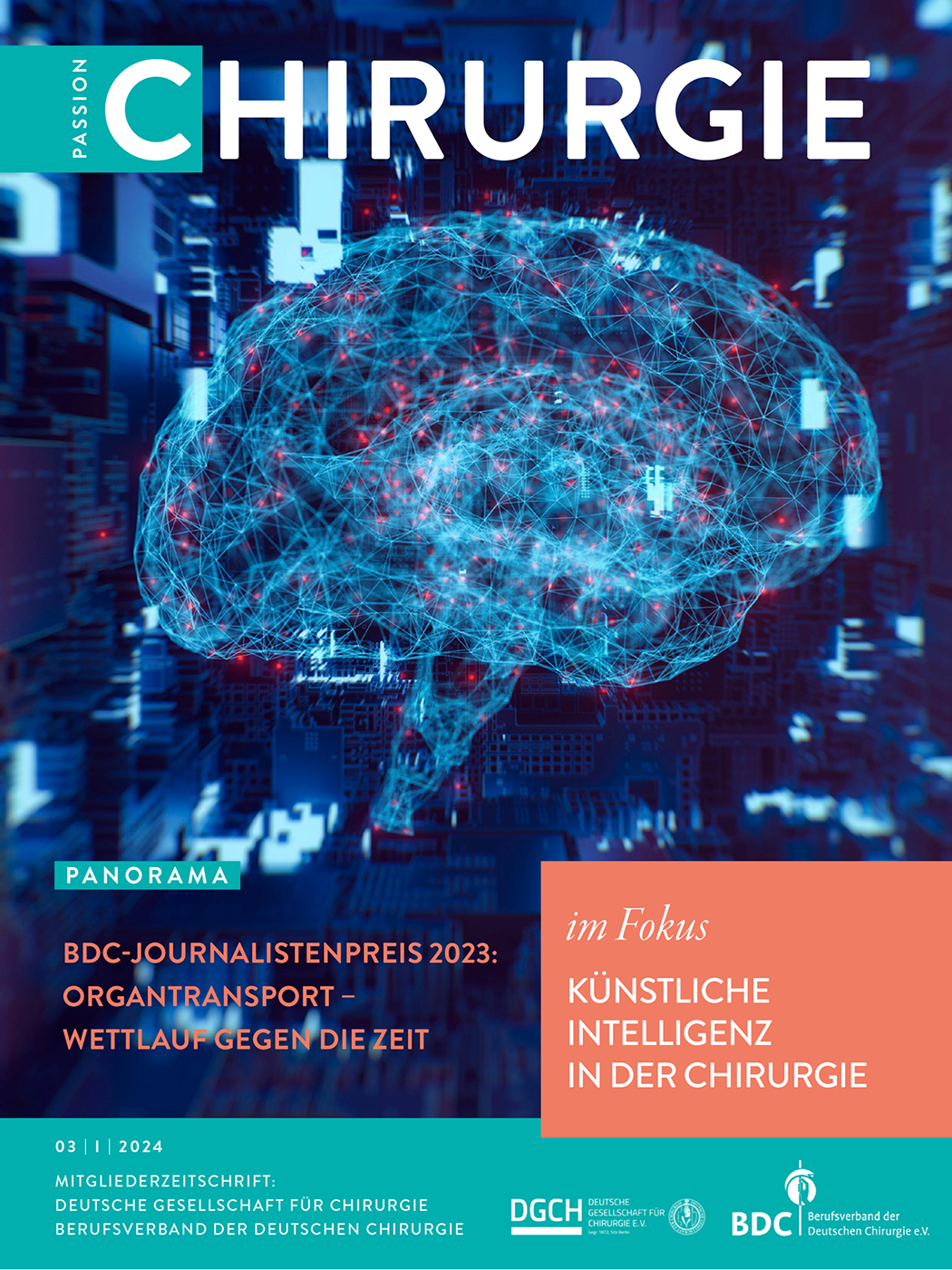01.05.2013 Fehlermanagement
Safety-Clip: Das Global Trigger Tool – Messinstrument der Patientensicherheit

Das Global Trigger Tool (GTT) wurde vom amerikanischen Institute for Healthcare Improvement (IHI) als aktives Messinstrument der Patientensicherheit erstmalig 1999 zur Entdeckung von unerwünschten Ereignissen in der medikamentösen Therapie erprobt. Sein Anwendungsbereich wurde seitdem erweitert, sodass nun ein reliables, quantitatives Messinstrument für unerwünschte Ereignisse während einer Krankenhausbehandlung zur Verfügung steht. Die Datenerhebung erfolgt ausschließlich durch Sichtung von Patientenakten. Die Verbreitung der Anwendung des Instrumentes ist vor allem in anglo-amerikanischen Krankenhäusern vorangeschritten. Im deutschsprachigen Raum kommt das Tool seit 2009 in vorerst wenigen Krankenhäusern zum Einsatz. Eine deutsche Übersetzung des GTT-Manuals steht mittlerweile zur Verfügung und entstammt einem Projekt der Fachhochschule Flensburg zur Patientensicherheit [1]. Das Ziel der Anwendung des GTT in einem Krankenhaus ist es, in regelmäßigen Abständen ein Abbild von unerwünschten Ereignissen während der Behandlung zu erhalten.
Die Abgrenzung des Global Trigger Tool zum Critical Incident Reporting
Im Gegensatz zu einem Critical Incident Reporting System (CIRS), in dem unerwünschte Ereignisse durch die Mitarbeiter eines Krankenhauses gemeldet werden können, bietet die Anwendung des Global Trigger Tools (GTT) ein kontinuierliches Monitoring über Ereignisse (Tab. 1). Ein CIRS verlässt sich auf die Meldebereitschaft der Mitarbeiter und wird als freiwilliges Meldesystem erachtet. Das Global Trigger Tool wird systematisch und kontinuierlich angewendet, d. h. ein Team von drei Reviewern sichtet regelmäßig Patientenakten nach dem Auftreten von „Triggern“, die Hinweise auf mögliche Patientenschädigungen geben. Aufgrund der Freiwilligkeit eines Meldesystems wie CIRS geht man davon aus, dass nur 10 bis 20 Prozent der tatsächlich auftretenden unerwünschten Ereignisse darin erfasst und ausgewertet werden [2]. Bei der Sichtung von Patientenakten nach Maßgabe des Global Trigger Tools findet eine kontinuierliche Stichprobenerhebung zu unerwünschten Ereignissen statt. Die daraus resultierenden Ergebnisse lassen Interpretationen zur Inzidenz der Ereignisse im Verhältnis zu einer definierten Kennzahl von Behandlungstagen oder Patientenaufnahmen zu.
Tab. 1: Vergleich CIRS-GTT
| CIRS | Global Trigger Tool |
| Erfassung von Beinahe – Ereignissen, aber keinen Patientenschäden | Erfassung von unerwünschten Ereignissen mit Interventionsbedarf bis hin zur Patientenschädigung |
| Vorwiegend qualitative Auswertung von beitragenden Faktoren zu einem Beinahe-Ereignis | Quantitative Auswertung in vorgegebenen Kategorien zur Häufigkeit und zum Grad der Patientenschädigung |
| Identifizierung von Fehlerursachen und Ermittlung von Risikopotentialen für Behandlungsfehler | Suche nach dem Vorhandensein von unerwünschten Ereignissen, die mit einem Trigger assoziiert sind |
| Erfassung der Ereignisse ist abhängig von der Meldebereitschaft der Mitarbeiter | Systematische und kontinuierliche Erfassung der Ereignisse durch ein Reviewer-Team |
| Keine reliable Aussage zum Auftreten von Ereignissen im Verhältnis zu Behandlungstagen oder Patientenaufnahmen/Jahr möglich. | Die Anzahl der ermittelten Ereignisse wird ins Verhältnis zu Behandlungstagen oder Patientenaufnahmen gesetzt |
Die Anwendung des Global Trigger Tools in Anlehnung an die Empfehlungen des IHI [3]
Ein Reviewer-Team sichtet regelmäßig und gemeinsam zu einem vordefinierten Zeitpunkt abgeschlossene Patientenakten (ca. 20 Akten pro Monat, die mindestens 30 Tage alt sind). Dabei handelt es sich um per Zufall ausgesuchte Akten von erwachsenen Patienten, die mindestens 24 Stunden in stationärer Behandlung waren und nicht um bereits identifizierte „Schadenakten“.
Anhand der definierten „Trigger“ (Tab. 2), nach denen man in den Akten sucht, werden Hinweise auf Patientenschäden gesammelt und kategorisiert. Ein Trigger ist als Warnsignal zu verstehen, der wichtige Hinweise auf das Vorliegen einer Patientenschädigung geben kann. Ein Trigger, der bei der Durchsicht der Patientenakte gefunden wurde, wird als „positiv“ gekennzeichnet. Er muss aber nicht automatisch mit einem Patientenschaden in Verbindung stehen. Nach Identifizierung eines Triggers in der Akte wird in einem weiteren Schritt ermittelt, ob es zu einem Personenschaden gekommen ist. Die kausale Verknüpfung des Triggers mit dem Personenschaden wird als „adverse event“ (= Schadenereignis) bezeichnet und nur dieses Ereignis wird in der Erhebung statistisch erfasst.
Die Übersetzung der englischen Definition zum Patientenschaden durch das IHI lautet:
„Unbeabsichtigte körperliche Schäden, die durch Untersuchungen, Behandlung und Pflege verursacht wurden und eine zusätzliche Überwachung, eine Behandlung oder die Aufnahme in ein Krankenhaus erfordern oder zum Tode des Patienten beitragen.“ [4]
Tab. 2: Trigger
| Module | Trigger (auszugsweise) |
| Generelle Behandlung |
|
| Medikation |
|
| Chirurgisch |
|
| Intensivbehandlung |
|
| Perinatale Behandlung |
|
| Notaufnahme |
|
Bei der manuellen Durchsicht der Krankenunterlagen durch das Reviewer-Team geht es ausschließlich um das Auffinden der Kombination von Triggern mit ursächlichem Schadenereignis und nicht um die Ursache des Fehlers oder die den Fehler zu verantwortende Person. Die Sichtung gleicht eher einem Scan-Vorgang als einem aktiven Lesen der Akte. Aufgrund der zeitlichen Limitierung der Aktendurchsicht auf 20 Minuten pro Akte soll ein repräsentativer Ausschnitt aufgezeigt werden, jedoch nicht die komplette Ermittlung aller Schäden pro Patient. Es wird auch nicht zwischen vermeidbaren oder nicht vermeidbaren Schäden unterschieden.
Das Reviewer-Team besteht aus mindestens drei qualifizierten Mitarbeitern des jeweiligen Krankenhauses, die medizinische Kenntnisse besitzen, die Aktenstruktur kennen und allgemeine Kenntnisse über die Krankenhausbehandlung haben. Davon muss ein Mitglied Arzt sein. Die Konzentration richtet sich dabei auf die Akteninhalte Epikrise, Diagnosen, Medikamentenverordnung, Laborresultate, OP-Dokumentation und Verlaufseinträge des Personals.
Das durch den Trigger identifizierte „adverse event“ wird einer Schadenskategorie E bis I (Tab. 3) zugeordnet. Mit Hinblick auf die Kategorisierung von Schäden verwendet das GTT den weltweit gültigen Katalog des NCC MERP: „National Coordination Council for Medication Error Reporting and Prevention Index“ [5].
Tab. 3: NCC MERP-Kategorien
| Kategorie | Definition |
| E | Temporärer Patientenschaden, der eine Intervention erfordert |
| F | Temporärer Patientenschaden, der einen Krankenhausaufenthalt oder eine Verlängerung des Krankenhausaufenthaltes erfordert |
| G | Permanenter Patientenschaden |
| H | Patientenschaden, der eine lebenserhaltende Intervention erfordert |
| I | Patientenschaden, der zum Tod des Patienten beigetragen hat |
In der traditionellen Darstellung der Ergebnisse wird die Anzahl der ermittelten und kategorisierten Patientenschäden im Verhältnis zu den Behandlungstagen angezeigt. Die Formel lautet:
Anzahl der Patientenschäden
_________________________________________________________
Summe der Behandlungstage für alle untersuchten Akten x 1000
Alternativ ist die Darstellung der kategorisierten Patientenschäden im Verhältnis zu 100 Aufnahmen möglich.
Als Referenzhinweis für Durchschnittswerte dient eine Datensammlung aus mehreren US-Krankenhäusern, die folgende Verhältnisse ergab [6]:
-
-
- 90 Patientenschädigungen pro 1.000 Behandlungstage
- 40 Patientenschädigungen pro 100 stationäre Aufnahmen
-
Für und Wider des Einsatzes des GTT im klinischen Risikomanagement
Es ist eine Verlaufskontrolle des Auftretens von Patientenschädigungen über definierte Zeitperioden möglich. Bei längerer Anwendung kann auch der Erfolg von risikopräventiven Maßnahmen anhand der Reduktion der Häufigkeiten oder Änderungen in der Klassifizierung abgeleitet werden. Damit wird der Nachweis einer Reduktion der Ereignisse über einen definierten Zeitraum numerisch demonstrierbar. Die Eignung des GTT zur Darstellung von Verlaufsänderungen in der Häufigkeit unerwünschter Ereignisse ist auch in Studien nachgewiesen [7]. Das methodische Vorgehen der Triggeridentifizierung fördert ein zügiges und kontinuierliches Zusammentragen von Fakten über Ereignisse in bestimmten Behandlungsabschnitten (siehe Module in Tab. 2). Dies bietet den für die Patientensicherheit Verantwortlichen eines Krankenhauses Orientierung und Entscheidungshilfen zum gezielten Einsatz von Verbesserungsmaßnahmen.
Damit eine Aktensichtung in der Regelmäßigkeit stattfinden kann, die Aussagen im Sinne einer Verlaufskontrolle von Ereignissen ermöglicht, müssen personelle Ressourcen bereitgestellt werden. An Aufwand dafür entstehen die Schulung und das Training der ausgewählten Reviewer zur Erzeugung einer hohen Interrater-Reliabilität und nicht zuletzt die zeitliche Freistellung für die Aktensichtung. Da derzeitig noch ein Mangel an Programmen für computerbasierte Triggererhebungen herrscht, muss die Datensammlung manuell erfolgen. Bisher sind computergestützte Erhebungen für Trigger anhand einer elektronischen Patientenakte nur punktuell für einige ausgewählte Trigger möglich.
Die Datenerhebungen geben überhaupt keinen Aufschluss über tiefergehende Ursachen von menschlichen Fehlleistungen oder organisatorischer Faktoren für Fehlbehandlungen, wie sie z. B. aus Verfahren zur Root Cause Analyse bekannt sind [8].
Resümee
Das Tool dient der statistischen Erhebung unerwünschter Vorkommnisse und Schadensfälle. Eine kategorisierte Übersicht der Schweregrade der Vorkommnisse wird generiert. Aus der Anwendung des GTT ergibt sich die Identifizierung von Patientenschädigungen. Man kann das Tool nutzen, um den Verlauf der Häufigkeit von unerwünschten Ereignissen aufzeigen und um nachzuweisen, ob risikopräventive Interventionsmaßnahmen Einfluss auf das Auftreten von unerwünschten Ereignissen haben.
Im Rahmen eines strategischen, klinischen Risikomanagements kann die Nutzung des Tools dazu beitragen, Häufigkeitsaussagen zu Patientenschäden zu machen und diese als Basis für weitere risikopräventive Maßnahmen herzunehmen. Es werden Ereignisse ans Tageslicht gefördert, die sich nicht in einer Anspruchsstellung oder Schadenakte wiederfinden, weil es nie einen Anspruchsteller dazu gab. Es werden viele Vorkommnisse (z. B. Zustandsverschlechterung eines Patienten, erneute Operation, ungeplanter Aufenthalt auf Intensivstation) identifiziert, die vielleicht vom Krankenhauspersonal als „Alltag“ angesehen werden und deshalb nicht anderweitig erfasst werden. Man ist sich oft zu wenig bewusst, was ein Vorkommnis für den Patienten selbst bedeutet. Deshalb können mit Hilfe des GTT’s die Fülle dieser „unerkannten“ Vorkommnisse genutzt werden, um anhand der Ergebnisse bei den Mitarbeitern die Motivation zum Ergreifen von Verbesserungsschritten in der Patientensicherheit zu wecken. Damit wird ein wichtiger Grundstein für weitere, gezielte risikopräventiven Maßnahmen zur Steigerung der Patientensicherheit gelegt.
Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via [email protected].
Herold A. Safety Clip: Das Global Trigger Tool. Passion Chirurgie. 2013 Mai; 3(05): Artikel 03_02.
Autor des Artikels
Angela Herold
GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH, MünchenWerner-Eckert-Str. 1181829München kontaktierenWeitere Artikel zum Thema
29.01.2024 Fehlermanagement
BGH-Urteil: Aufklärung muss individuell erfolgen und darf Risiken nicht verharmlosen
Ein Aufklärungsbogen ersetzt das mündliche Aufklärungsgespräch nicht, denn die Aufklärung muss sich am individuellen Risikoprofil der Patientin oder des Patienten orientieren. Verharmlost das Formular beispielsweise spezifische, in der Person des Patienten liegende Risiken und ruft damit eine Fehlvorstellung über die mit dem Eingriff verbundene Komplikationsgefahr hervor, trifft die Ärztin oder den Arzt ein Aufklärungsversäumnis, sofern er beziehungsweise sie nicht im Gespräch über das tatsächliche Risiko für die Person aufgeklärt hat.
01.09.2020 Fehlermanagement
Safety Clip: Sicherheitsmanagement: Mit dem Unerwarteten umgehen. Die Konzepte Safety-I und Safety-II unter der Lupe
Seit der Veröffentlichung des Berichtes „To Err Is Human: Building a Safer Health System“ im Jahr 1999 ist das Thema Patientensicherheit von Jahr zu Jahr bedeutender geworden. Gesetzgeber, nationale und internationale Organisationen und auch Patientenorganisationen stellen immer weitere Anforderungen an ein klinisches Risikomanagement, sie wollen damit die größtmögliche Patientensicherheit erreichen. Gesundheitseinrichtungen – ambulante wie stationäre – stehen vor der Herausforderung, dem nachzukommen.
12.06.2020 Fehlermanagement
Safety Clip: Wärmemanagement im OP
Spätestens seit der 2014 eingeführten S3-Leitlinie „Vermeidung von perioperativer Hypothermie“, die im Jahr 2019 eine Aktualisierung erfahren hat, können Maßnahmen zur Vermeidung eines Abfalls der Körperkerntemperatur unter 36 Grad Celsius nicht mehr negiert werden.
01.01.2020 Fehlermanagement
Sicherheit ist kein Projekt, das man mal vier Wochen macht
Technik ist gut und schön – solange sie funktioniert. Das gilt für die Informationstechnologie (IT) in Betrieben besonders, denn ohne IT laufen viele betriebliche Prozesse gar nicht mehr. Einen kleinen oder größeren Schaden hat fast jedes Unternehmen schon erlebt – mit unangenehmen Folgen. Wie man sich vor IT-Schäden schützt und was man ganz praktisch tun kann, erläutert Frank Rustemeyer von HiSolutions, Partner der Ecclesia Gruppe, im Interview.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.