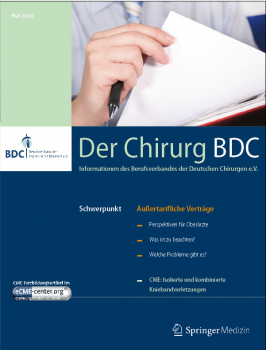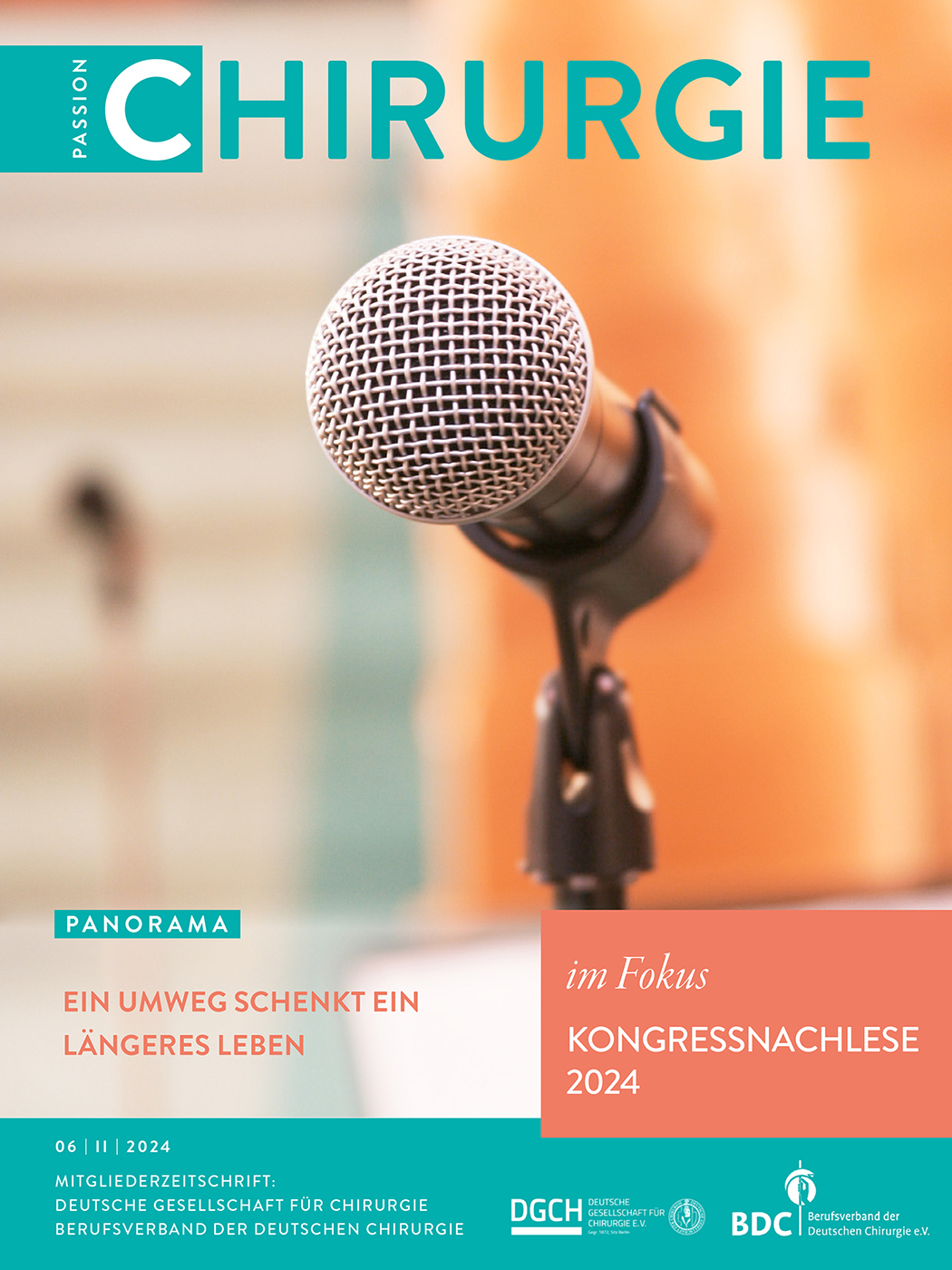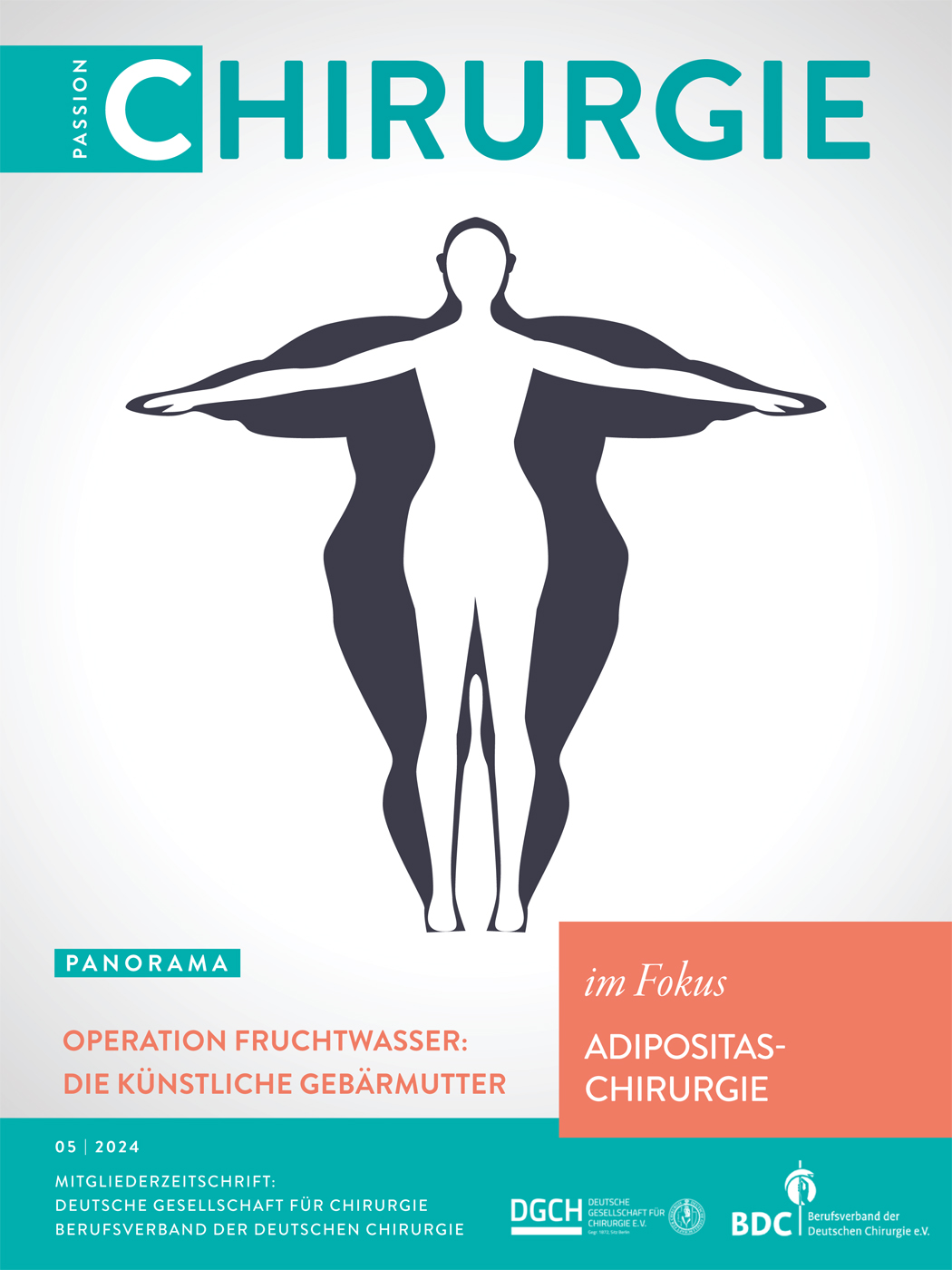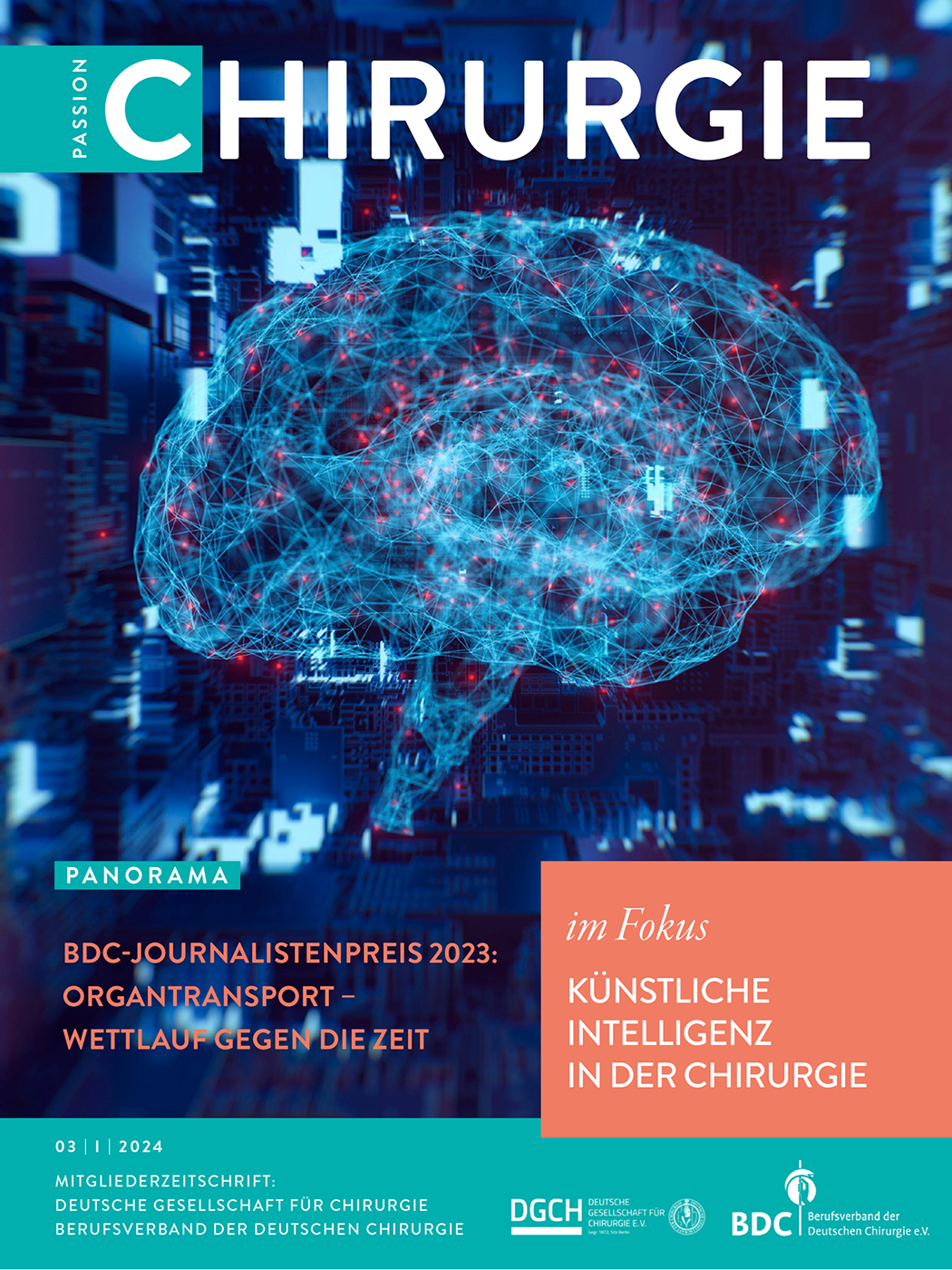01.05.2010 Safety Clip
Safety Clip – Bein-Amputation nach Routineeingriff durch Kompartmentsyndrom

Ein derartiger Fall sorgte in Berlin Anfang 2010 für Schlagzeilen. Im Zusammenhang mit einem mehrstündigen gynäkologischen Eingriff in Steinschnittlagerung war es bei einer Patientin zu einer schwerwiegenden Durchblutungsstörung in der unteren Extremität gekommen, die eine Amputation erforderte. Ähnliche Fälle sind in der Literatur beschrieben. An der MHH wurden 2007 iatrogene Nervenschädigungen in der Gynäkologie untersucht. In 4 von insgesamt 46 Fällen handelte es sich bei den Schädigungen um ein Kompartmentsyndrom.
| Kompartmentsyndrom: Gewebedruckerhöhung in geschlossenen, von Fascien umgebenen Räumen(Logen), die zu einer Störung der Mikro- und Makrozirkulation führt. Daraus können vorübergehende oder dauernde Funktionsbeeinträchtigungen von Nerven und Muskeln resultieren. |
In den Schadendaten der Ecclesia Versicherungsdienst GmbH tritt das Kompartmentsydrom als postoperative Komplikation in folgenden Fallkonstellationen auf:
- Bei einem elektivem Eingriff (Bauchchirurgisch, urologisch, gynäkologisch) entsteht eine Gefäßverletzung. Das daraus resultierendes Risiko der Durchblutungsstörung in den unteren Extremitäten und die Gefahr eines Kompartmentsyndroms wird in der postoperativen Phase nicht bedacht, die Diagnose zu spät gestellt.
- Durch fehlerhafte (Steinschnitt-) Lagerung auf dem OP-Tisch in Verbindung mit risikoerhöhenden Faktoren wie langer OP-Dauer und einer bestehenden Adipositas des Patienten entwickelt sich eine massive Durchblutungsstörung in den Beinen. In den Gutachten werden bspw. die unterlassene Kontrolle der Durchblutung der Extremitäten während des operativen Eingriffs sowie unzureichende Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Druckschäden bemängelt.
In einigen Fällen wird der postoperativ auftretende Druckschmerz und die Schwellung als Hinweis auf eine Beinvenenthrombose interpretiert. Durch eine solche Fehldiagnose verstreicht wertvolle Zeit und der bei einem Kompartmentsyndrom erforderliche Noteingriff (Fascienspaltung) erfolgt verspätet oder kann überhaupt nicht mehr durchgeführt werden. Im Extremfall führt die Ischämie zu Nekrosen, zahlreichen (bis zu 15!) Folgeoperationen und zur Amputation von Körperteilen.
Risikomanagement
Es gibt keine gesicherten Erkenntnisse, wie man bei mehrstündigen Eingriffen, die eine extreme Positionierung des Patienten erfordern, die Entstehung eines Kompartmentsyndroms wirksam verhindern kann. Zu den üblichen Sorgfaltspflichten für das Operationsteam gehören Lagerungsstandards, bei denen geeignete Präventionsmaßnahmen zur Druckreduzierung eingesetzt werden. Die Lagerungsart, dabei verwendete Lagerungshilfsmittel sowie Befunde (Durchblutungskontrollen) sind zu dokumentieren.
Risikopräventiv wäre es, die Gefahren der Steinschnittlagerung, die Symptome des Kompartmentsyndroms sowie aus der Diagnose resultierende chirurgische Notfallsituation in der ärztlichen Weiterbildung zu vermitteln.
Klinische Anzeichen
|
Kompartmentsyndrom in der Traumatologie
Die Druckerhöhung in Muskellogen als Folge schwerwiegender Traumen, insbesondere an den unteren und oberen Extremitäten, ist ein bekanntes Phänomen. Unter forensischen Gesichtspunkten ist eine erhöhte Aufmerksamkeit für diese Thematik in der Unfallchirurgie geboten, da funktionelle Defizite der Extremitäten nach adäquater und erfolgreicher Behandlung von Knochenbrüchen auf einem übersehenen oder unbehandelten Kompartmentsyndrom beruhen können.
Die Schadendatenauswertungen lassen folgende Ursachen für die Haftpflichtanspruchsstellungen erkennen:
- Diagnosefehler in der Erstdiagnostik (Rettungsstelle) in Form nicht erkannter Gefäßverletzung oder zu spät erkannter Durchblutungsstörung.
- Behandlungsfehler in der Primärversorgung von Unfallverletzungen, z.B. konservative Behandlung, fehlerhaft angelegter Gipsverband.
- Nach einer Frakturversorgung wird die Diagnose Kompartmentsyndrom verspätet gestellt. Unzureichende Überwachung des Patienten und der Durchblutung der betroffenen Extremität in der postoperativen Phase. Differentialdiagnostik unterlassen.
- Verzögerte Behandlung eines Kompartmentsyndroms, bspw. weil Hinzuziehung von Spezialisten oder Verlegung in eine Spezialklinik verzögert erfolgte.
- Fehlerhafte Behandlung der Komplikation, z.B. unvollständige Fascienspaltung.
Risikomanagement
In der unfallchirurgischen Primärversorgung sollte das Behandlungsteam die Entstehung eines Kompartmentsyndroms einkalkulieren bei Frakturen (insb. bei Schaftfrakturen, bei kindlichen Frakturen), Dislokation der großen Gelenke mit Muskel- und Gefäßzerreissung, ausgedehnten Weichteilverletzungen.
Besteht das Risiko der Entstehung eines Kompartmentsyndroms, so ist die engmaschige Überwachung des Patienten und hierbei speziell die Prüfung der betroffenen Region erforderlich. Durch regelmäßige Arztvisiten sowie konkrete Instruktionen für das Pflegepersonal ist der Behandlungsverlauf besonders in den ersten 24h engmaschig zu beobachten und zu dokumentieren.
Bei bewusstlosen Patienten kann in den betroffenen Logen eine direkte Druckmessung durchgeführt werden. Die Trendentwicklung der Messwerte kann eine Entscheidungshilfe sein.
Diagnose Kompartment: Die Zeit läuft!
Wird die Diagnose Kompartmentsyndrom gestellt, so ist rasches Handeln geboten. Zu den allgemeinen Erstmaßnahmen gehört die breite Spaltung aller einengenden Verbände. Die betroffene Extremität sollte nicht über Vorhofniveau gelagert werden.
Durch eine zügig und fachgerecht ausgeführte Fasciotomie können häufig die Gewebeschädigungen in ihrem Ausmaß reduziert und Folgeschäden vermindert werden.
Literatur:
Für immer verloren: Komplikation während einer Routine-OP in der Charité: Die Ärzte amputieren einer Patientin ein Bein. Tagesspiegel; 25.01.2010, Ingrid Müller
Castellani, C., Amerstorfer, F, Weinberg, A.M.: Das Kompartmentsyndrom des Unterschenkels im Kindesalter. Universitätsklinik für Kinderchirurgie, Medizinische Universität Graz
Grechenig, W. Pichler, N.P. Tesch: Kompartmentsyndrom – Fasciotomie. Univerisitätsklinik für Unfallchirurgie, LKH Graz
Krahn, N.E.: Das akute Kompartmentsyndrom (Dissertation, 2005), BG Klinik Bochum
Lukojanova, A.: Iatrogene Nervenläsionen in der Gynäkologie (Dissertation, 2007), Neurologische Klinik der MH Hannover
Autor des Artikels
Mechthild Siering
Dipl. Kauffrau (Pflegemanagement), Fachkrankenschwester und Risiko-BeraterinGRB-Gesellschaft für Risiko-Beratung mbHKlingenbergstr. 432758Detmold kontaktierenWeitere Artikel zum Thema
01.03.2024 Safety Clip
Safety Clip: Die EU-Medizinprodukte-Verordnung für mehr Patientensicherheit
Der Markt für Medizinprodukte und die damit einhergehenden Anforderungen haben seit 2010 durch einen aufgedeckten Skandal viel Aufmerksamkeit erhalten. Der französische Hersteller Poly Implant Prothèse (PIP) entschied sich unter anderem aus Kostengründen dafür, ein unzulässiges Industriesilikon für seine Brustimplantate zu verwenden.
01.12.2023 Safety Clip
Safety Clip: Die Patientensicherheit fördern mit Ansätzen aus dem „Magnet Recognition Program®“
Das aus dem US-amerikanischen stammende Konzept und Zertifizierungsverfahren „Magnet Recognition Program®“, im Deutschen meist als „Magnetkrankenhaus“ bezeichnet, enthält vielfältige Vorgaben, um Krankenhäuser zu exzellenten Organisationen zu entwickeln.
01.11.2023 Safety Clip
Safety Clip: Von der Wundversorgung zum Wundmanagement
Täglich finden in Praxen, medizinischen Versorgungszentren (MVZ), Ambulanzen und Notaufnahmen von Kliniken Wundversorgungen für Patientinnen und Patienten statt. In der Regel verläuft die primäre Wundheilung problemlos, wie zum Beispiel bei frischen infektionsfreien Verletzungen oder aseptischen Operationswunden. Nach ca. zehn Tagen ist eine primäre Wundheilung komplikationslos abgeschlossen und hinterlässt eine nur minimale Vernarbung.
01.10.2023 Safety Clip
Safety Clip: Morbiditäts und Mortalitätskonferenzen zur Förderung der Sicherheitskultur
Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen (MMK) finden seit Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Der Anteil an MMK in Allgemeinkrankhäusern ist in den letzten acht Jahren deutlich gestiegen.1 Das liegt zum einen daran, dass in der „Qualitätsmanagement-Richtlinie vertragsärztliche Versorgung“ (QM-RL) des Gemeinsamen Bundesausschusses aus dem Jahr 2016 die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen im Teil B § 1 Satz 6 QM-RL beispielhaft als Instrument des klinischen Risikomanagements aufgeführt werden, zu dessen Einführung die stationären Einrichtungen verpflichtet sind.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.