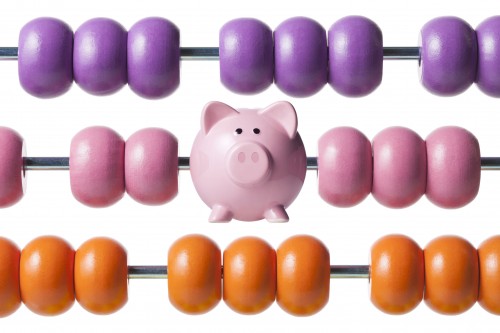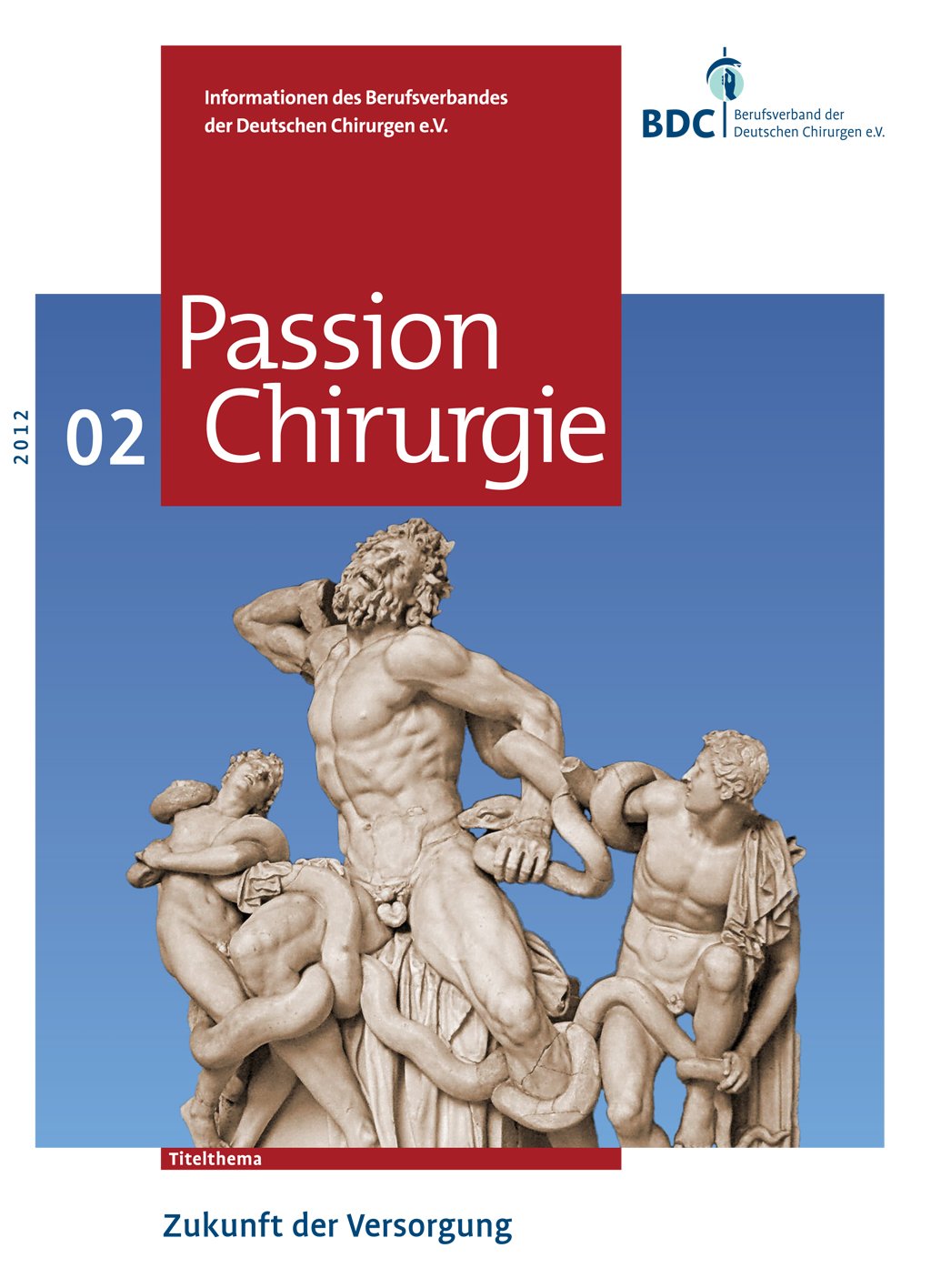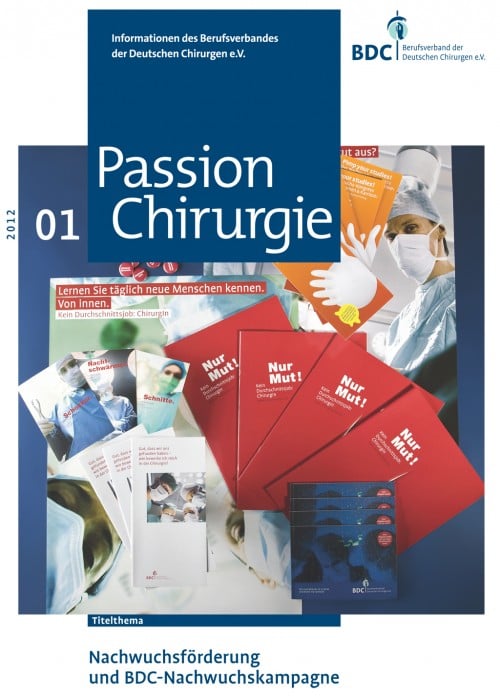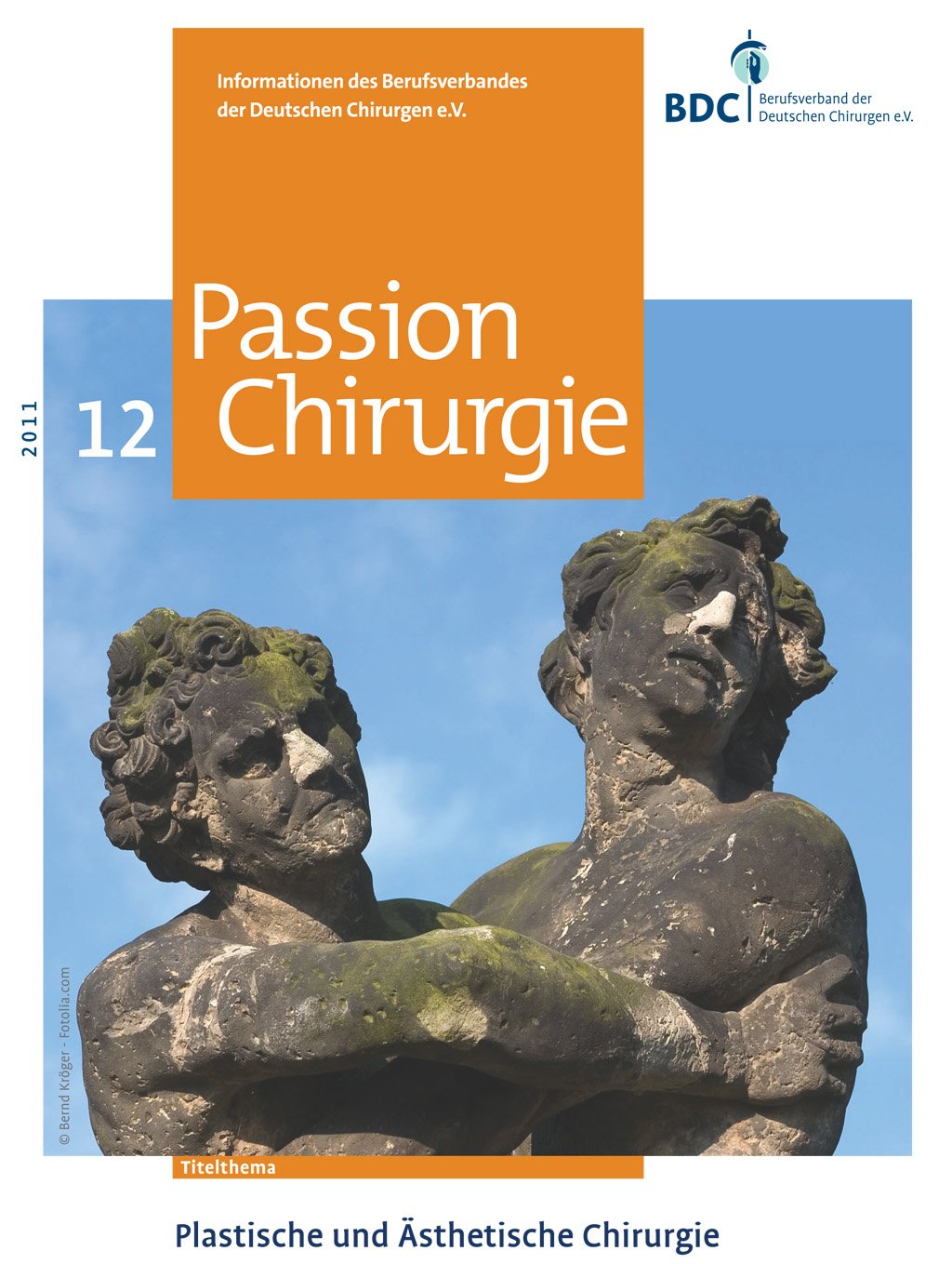01.01.2018 Panorama
Unfallchirurgen erinnern an Schicksale jüdischer Kollegen während des Nationalsozialismus

Die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. (DGU) hat an die Schicksale ihrer 36 ehemaligen jüdischen Mitglieder erinnert. Die Gedenkstunde fand am Gründungsort der DGU im Jahr 1922 an der Alma Mater Lipsiensis statt. Zuvor verlegte der Künstler und Initiator der STOLPERSTEINE Gunter Demnig 36 Stolpersteine und zwei Stolperschwellen vor dem Haupteingang des Leipziger Universitätsklinikums (UKL). „Wir wollen die Erinnerung an unsere jüdischen Kollegen wachhalten und ihrer mit diesem Mahnmal mit Dank, Hochachtung und in Demut gedenken“, sagte DGU-Präsident Professor Dr. Ingo Marzi.
Auf den zehn mal zehn Zentimeter großen, mit einer Messingplatte bedeckten Steinen ist jeweils Name, Jahrgang und Schicksal dieser Ärzte eingraviert. Sie wurden während der Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 gedemütigt und entrechtet, indem man ihnen teils die Promotion, Approbation bzw. die Kassenzulassung entzog oder ihnen ein Lehrverbot erteilte. Viele von ihnen flohen ins Ausland, einige in den Tod, fünf wurden deportiert und drei sogar ermordet. „Sie hatten sich wie ihre heutigen Kollegen für diesen Beruf entschieden, um Menschen zu helfen und zu heilen. Ihr Schicksal berührt uns noch immer. In tiefer Verbundenheit stellen wir daher sehr gern diesen Ort des Gedenkens zur Verfügung“, sagte Professor Dr. Wolfgang E. Fleig, Medizinischer Vorstand des UKL. Professor Dr. Ingo Bechmann, Prodekan der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig, erinnerte in seinem Grußwort an den Leipziger Privatdozenten Dr. Ernst Bettmann: Ihm wurde seine an der Leipziger Medizinischen Fakultät 1932 erworbene Habilitation für das Fach Orthopädie bereits Ende 1933 entzogen.
Nach seiner Flucht 1937 in die USA wurde er in New York ein bedeutender orthopädischer Chirurg, zu dessen Patienten u.a. der berühmte Dirigent Fritz Busch zählte.Die Daten der 36 jüdischen DGU-Mitglieder lagen der Fachgesellschaft lange nicht vor: Denn durch die Kriegswirren gingen alle vereinsrechtlichen Unterlagen der damaligen verfolgten Mitglieder verloren. Erst in den letzten zehn Jahren gelang es der DGU durch den Zugriff auf verschüttete Quellen, die bruchstückhaften und manchmal vagen Überlieferungen nach und nach gesichert aufzufinden.
Durch die Unterstützung zahlreicher Institutionen konnte die DGU die Mitgliederdaten weitestgehend wiederherstellen. Von großer Bedeutung war dabei der Abgleich der Daten mit dem Reichsarztregister durch die Kassenärztliche Vereinigung Berlin. Demnach hatte die DGU zu Beginn des Nationalsozialismus ca. 300 Mitglieder. Die Vereinstätigkeit und die Jahrestagungen der DGU wurden mit Kriegsbeginn im Jahr 1939 eingestellt und erst 1950 mit der Wiedergründung der Gesellschaft in Bochum erneut aufgenommen.

Federführend bei der Recherche zum Gedenken an die jüdischen Mitglieder war der im Herbst 2016 verstorbene und frühere Generalsekretär Professor Dr. Jürgen Probst. Sein Anliegen: Das Wachhalten der damaligen Ereignisse und das Gedenken an die Kollegen der Verfolgungsjahre. Aus dessen Rede auf der DGU-Mitgliederversammlung im Oktober 2013 zitierte heute Professor Dr. Hans Zwipp, Sprecher der DGU-Senatoren und Stolperstein-Projektleiter: „Und so wollen wir unsere früheren jüdischen Mitglieder menschlich wieder in unsere Gesellschaft aufnehmen und wieder in unser Herz einschließen.“Die 36 ehemaligen Mitglieder kamen aus allen Teilen des damaligen Deutschlands – darunter Orte wie Berlin, Hamburg, Köln und Leipzig.
Sie dienten nicht nur ihrem Vaterland und ihren Patienten, sondern engagierten sich ehrenamtlich unter anderem als Schriftführer, Schatzmeister oder 1. Vorsitzender der DGU. Sechs von ihnen waren sogar Gründungsmitglieder, als die DGU am 23.9.1922 im Auditorium 30 der Universität Leipzig unter der damaligen Bezeichnung Deutsche Gesellschaft für Unfallheilkunde, Versicherungs- und Versorgungsmedizin gegründet wurde. Anlass war die hundertjährige Tagung der Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte (DGNÄ).Das Projekt STOLPERSTEINE gilt zwischenzeitlich als größtes dezentrales Mahnmal der Welt. Mittlerweile sind über 63.000 Stolpersteine, nicht nur in Deutschland, sondern in weiteren 21 europäischen Ländern verlegt. In Deutschland sind Stolpersteine inzwischen in über 1.200 verschiedenen Orten zu finden.
Zum Nachlesen
Gedenken der jüdischen Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Unfallheilkunde, Versicherungs- und Versorgungsmedizin, Jürgen Probst, Orthopädie und Unfallchirurgie Mitteilungen und Nachrichten, Oktober 2013, S.606-613
Damit sie nicht vergessen werden! Eine Spurensuche zum Leben und Wirken jüdischer Ärzte in Leipzig, Andrea Lorz, Passage-Verlag, 1. Februar 2017
Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 1933-1945. Band II: Die Verfolgten, Rebecca Schwoch, hrsg. von Hartwig Bauer, Ernst Kraas und Hans-Ulrich Steinau im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, Kaden Verlag Heidelberg 2017
Kurzbiografien der 36 ehemaligen jüdischen Mitglieder der DGU
DGU: Unfallchirurgen erinnern an Schicksale jüdischer Kollegen während des Nationalsozialismus. Passion Chirurgie. 2018 Januar, 8(01): Artikel 07_01.
Weitere aktuelle Artikel
27.07.2020 BDC|News
Der BDC – Meine Zukunftsvision
Ein runder Geburtstag bietet Anlass zu feiern, Vergangenes zu würdigen, den Moment zu schätzen und Zukunftspläne zu schmieden. Wo sehen wir uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Schöpfen wir unser volles Potenzial aus? Am 23. April 2020 wird der BDC 60 Jahre alt – sind wir auch für den 65. Geburtstag gerüstet?
23.07.2020 BDC|News
Mit Arroganz und Ignoranz kann kein Nachwuchs akquiriert werden
Der BDC feiert in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Joachim Meyer im Gespräch über Veränderungen in der Arbeitskultur und ihre Auswirkungen auf das Fach, über Effekte der Kommerzialisierung in der Medizin und wie Nachwuchskräfte gewonnen werden können.
01.07.2020 Entwicklungshilfe
Ist Albert Schweitzer ein zeitgemäßes Vorbild?
Der Urwaldmediziner Albert Schweitzer [1] sollte mein Leben seit meinem 7. Lebensjahr bestimmen. Die Inspiration durch die Biografie des Philosophen, Arztes, Musikers und Nobel-Laureaten gaben mir einen Weg vor, der für einen Einwanderersohn in Deutschland in den 1980er Jahren nicht selbstverständlich war.
01.07.2020 Schaufenster
Schaufenster Juli/August 2020
Empfindliche Honorareinbußen bei privatärztlichen Leistungen Jetzt haben es die Ärzte
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.