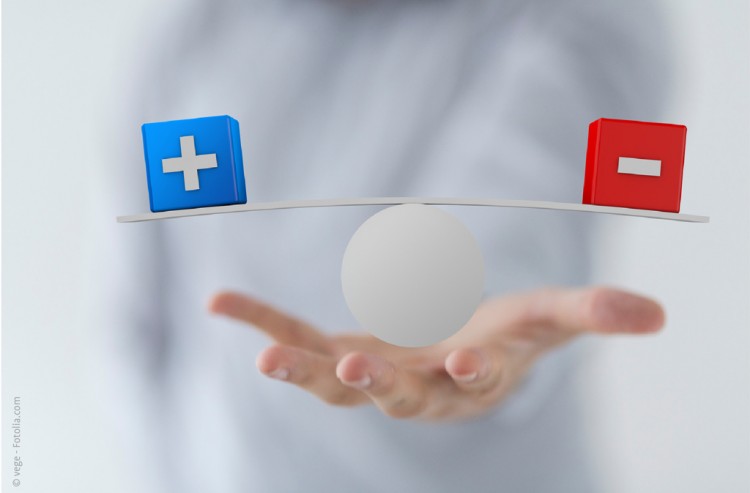Gut sein wollen wir alle! Krankheiten erkennen und dann richtig behandeln, d. h. Verfahren anwenden, die tatsächlich die Krankheit behandeln oder lindern und den Patienten idealerweise von seinen Beschwerden dauerhaft heilen – darum geht es. Doch woher wissen wir, ob wir das Richtige wissen und das richtige Wissen auch adäquat anwenden? Nun, immerhin haben wir sechs Jahre lang studiert. Das Problem ist, die Hälfte dessen, was wir während des Studiums gelernt haben, wird sich innerhalb der nächsten fünf Jahre nach Beendigung des Studiums als falsch oder völlig aus der Mode gekommen herausstellen. Leider wissen wir nicht, welche Hälfte. Beispiele dafür gibt es zahlreich. So hat die chirurgische Generation, der auch ich angehöre, noch gelernt, dass Gallenblasen in der Regel durch einen Rippenbogen-Randschnitt operativ entfernt werden und der Patient danach geheilt ist. Die Einführung der minimal invasiven Chirurgie in den frühen 90er Jahren wurde zum Teil als „Micky Maus-Chirurgie“ verlacht, war aber aufgrund der großen Erfolge und der wesentlich geringeren Nebenwirkungen auf den Patienten sehr schnell Goldstandard. Ebenfalls unumstritten war die Tatsache, dass Magengeschwüre durch Säure ausgelöst und durch Stress verursacht werden. Dies ist ebenfalls passé. Es vergingen knapp zehn Jahre bis zu der Erkenntnis, dass der Helicobacter pylori die Geschwüre verursacht und diese durch Antibiotikatherapie erfolgreich behandelt werden können. Die Erkenntnis von heute ist also möglicherweise der Irrtum von morgen.
Doch wie kommt der praktizierende Arzt tatsächlich zeitnah an das „richtige“, „saubere“ Wissen? Neue Erkenntnisse zur richtigen Diagnostik und Therapie von Krankheiten werden fast nur noch durch groß angelegte Studien an großen Patientenkollektiven gewonnen. Jede dieser Studien weist für sich die Möglichkeit des Irrtums, methodischer Probleme, der Verzerrung oder auch der Manipulation auf. Ihre Ergebnisse werden nicht selten im Interesse der Pharmaindustrie mit großem Elan auf den Markt gebracht. Immer öfter stellt sich im Nachhinein heraus, dass der große, dem Arzt und dem Patienten versprochene Fortschritt doch nur ein kleiner war und einer, der mit erheblichen Nebenwirkungen behaftet ist. Wie schützen wir uns vor irreführenden, pseudo-wissenschaftlichen Informationen? Und woher wissen wir, dass wir auf der Basis „sauberer“ Erkenntnisse tatsächlich die richtige Diagnose gestellt und damit die Behandlung überhaupt auf den richtigen Weg gebracht haben?
Und sind wir – last but not least – sicher, dass das, was wir tun, tatsächlich den Bedürfnissen und Erwartungen unserer Patienten entspricht? Nicht immer ist das, was der Arzt für richtig hält und macht, auch tatsächlich das, was dem Patienten ein besseres Leben und eine höhere Lebensqualität beschert. Diese Diskussion finden wir beispielsweise in der Therapie von onkologischen Erkrankungen tagtäglich wieder.
Mit dem „Zauberwort“ der „evidenzbasierten Medizin“ (EbM) wurde Mitte der 90iger Jahre der Schlüsselbegriff dafür kreiert, der uns allen aus diesen Nöten heraushelfen soll. „Die evidenzbasierte Medizin ist der gewissenhafte, ausdrückliche und angemessene Gebrauch der gegenwärtig besten, vorhandenen Daten aus der Gesundheitsforschung, um bei der Behandlung und Versorgung von konkreten Patienten Entscheidungen zu treffen. EbM beinhaltet die Integration individueller klinischer Expertise mit der bestmöglichen externen Evidenz aus klinischer Forschung und die Perspektive der Patienten“ (David Sackett) [1].
Was heißt das? Die evidenzbasierte Medizin fragt explizit und systematisch: Was will und braucht mein Patient eigentlich? Was muss ich dazu wissen? Stimmt das, was ich zu wissen glaube? Ist das Wissen auf den einzelnen Patienten anwendbar? Und, habe ich die therapeutischen Ziele tatsächlich erreicht? Evidenzbasierte Medizin beginnt mit der richtigen klinischen Diagnose und damit mit guten klinischen Fähigkeiten, Anamnese, Status- und Befunderhebung sowie ärztlichem Wissen und Erfahrung. In der Regel sind wir mit Fragen zur richtigen Therapie konfrontiert. Um diese beantworten zu können, sollte im Idealfall eine Recherche der Literatur und eine kritische Beurteilung derselben stattfinden. Per Internetrecherche und Zugang zu medizinischen Datenbanken bekommt man mit relativ wenig Übung und wenig Zeitaufwand zumindest Tendenzen heraus und ist in der Lage, die Aussagekraft von Studien einzuschätzen. Das dazu nötige Wissen ist vergleichsweise einfach zu erwerben. Auch der Verfasser dieser Zeilen, der unter anderem deshalb Chirurg geworden ist, weil er eine intensivere Beschäftigung mit Statistik vermeiden wollte, hat nach einem zweieinhalbtägigen Kurs zum „Critical Appraisal“ gelernt, wie man Studien grundlegend bewertet. Inzwischen ist dieses Wissen fast Allgemeingut geworden. Selbst Kurse für Patienten und Schüler vermitteln dieses Wissen. Ich darf hier auch die Broschüre „Kompetent als Patient“ der Techniker Krankenkasse, kostenlos als Download im Internet erhältlich, sehr empfehlen (Link am Ende des Artikels).
Ein Beispiel für eine „verzerrte“ Wahrnehmung ist die Darstellung von Studienergebnissen in Prozentangaben. Der Nutzen neuer Verfahren wird gerne in Prozentangaben vermittelt, da Schlagzeilen wie „Neues Medikament senkt die Herzinfarktrate um 30 %“ genauso aufhorchen lassen wie die Aussage, dass das Mammografiescreening die Sterblichkeit an Brustkrebs um 25 % senkt. Wir sind beeindruckt, lesen wir doch genau das, was wir eigentlich lesen wollen, nämlich, dass es etwas gibt, das dem Patienten hilft und unsere Arbeit damit erfreulich macht. Gleichwohl lohnt sich hier ein Blick auf die reinen Zahlen: Von eintausend Frauen sterben nach zehn Jahren in der Regel vier an Brustkrebs. Werden tausend Frauen zehn Jahre lang in einem Mammografieprogramm gescreent, so sterben in dieser Gruppe drei Frauen an Brustkrebs. Der Unterschied zwischen vier und drei Verstorbenen sind die besagten 25 %. Aus dem Blickwinkel einer Frau, die sich screenen lässt, bleibt leider die Erkenntnis, dass eben nur eine von tausend Frauen durch das Screening tatsächlich nicht an Brustkrebs verstirbt. So beträgt die relative Risikoreduktion 25 %, die absolute Risikoreduktion nur 0,1 %. Weiß man, dass falsch positive Befunde erhoben werden können, so muss man sich ärztlich und ethisch der Tatsache stellen, dass bei den gescreenten Frauen ca. zweihundert einen Befund bekommen, der aufwendig abgeklärt wird (Krebsverdacht!), und der sich im Nachhinein als nicht maligne herausstellt. Ich muss also tausend Frauen behandeln, um ein Menschenleben zu retten (number needed to treat = 1.000). Gleichzeitig löse ich bei einer von fünf Frauen einen Schaden aus, der ohne die Behandlung nicht entstanden wäre (Number needed to harm = 5).
Die irreführende Verwendung von Prozentangaben ohne Angabe darüber, ob es sich um eine absolute oder eine relative Risikoreduktion handelt, zeigt sich an einem anderen lebensweltlichen Beispiel noch wesentlich plastischer. Die meisten von uns hätten gerne viel Geld zur Verfügung. So löst die Frage, ob sie am Wochenende mehrere Millionen Euro steuerfrei bekommen möchten sowohl Neugierde, vor allen Dingen Skepsis aus. Wie können Sie Ihre Wahrscheinlichkeit, Multi-Millionär zu werden, um 50 % erhöhen? Füllen Sie bitte am Wochenende statt vier Kästchen auf dem Lottoschein sechs Kästchen aus und Sie haben Ihre Wahrscheinlichkeit um 50 % erhöht. Also bitte verlassen Sie sich bei Ihren Entscheidungen nicht auf Prozentangaben!
Alleine mit solchen Erkenntnissen wird man als Arzt verantwortungsbewusster und freier, man geht nicht jedem neuen Heilversprechen auf den Leim und ist gleichzeitig in der Verantwortung, sich eine eigene Meinung zu bilden.
Evidenzbasierte Medizin hilft somit dem Arzt, besser herauszufinden, was in der Medizin richtig und was falsch ist oder macht zumindest skeptisch. Er wird freier in seinen Entscheidungen und durch den expliziten Bezug auf die Bedürfnisse und Erwartungen seiner Patienten auch unmittelbarer. Die evidenzbasierte Medizin ist somit Technik und Tugend (Johannes Köbberling) [vgl. 2].
1998 wurde der erste bundesweite „EbM-Kongress“ in Deutschland von der Ärztekammer Berlin organisiert und die ersten Kurse, nach dem im Anschluss an den Kongress erarbeiteten „Curriculum Evidenzbasierte Medizin“ der Bundesärztekammer abgehalten. Einzelne Ärzte, vor allen Dingen aber auch Fachgesellschaften und andere ärztliche Organisationen haben sich des Themas dankbar angenommen und begonnen, inhaltlich die Spreu vom Weizen zu trennen. Moderne Leitlinien, die in der Regel von Fachgesellschaften oder übergeordneten Institutionen wie dem Ärztlichen Zentrum für Qualität in der Medizin/ÄZQ (Link am Ende des Artikels) zur Verfügung gestellt werden, sind evidenzbasiert, d. h. auf wissenschaftlich-systematischer Basis und – entsprechend der Darlegung von materiellen oder immateriellen Interessenskonflikten – mit unabhängiger Expertise erarbeitet.
Der mit der EbM eingeleitete politische Prozess war erheblich. Evidenzbasierte Medizin war anfänglich noch als „Kochbuchmedizin“ apostrophiert. Inzwischen bestreitet niemand mehr die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Medizin, die auf Daten, Belege und systematisch zusammengeführten Erfahrungen und nicht nur auf persönlichen Meinungen beruht. Im Praxisalltag wirkt sich dies beispielsweise folgendermaßen aus: „Der Weg zur EbM hat mich aus der Isolation der Landarztpraxis herausgeführt. Im PC-Zeitalter sind Informationen im ländlichen Abseits (fast) so zugänglich wie an Universitäten. Der fachliche Austausch mit Kollegen regional und überregional, auch z. B. im Rahmen von Qualitätszirkelarbeit und Seminaren zu EbM belebt und erleichtert den Praxisalltag, der Kontakt mit den Patienten wird offener und partnerschaftlicher, wobei der Prozess der Entscheidungsfindung wird allerdings nicht einfacher, sondern eher differenzierter und komplexer geworden ist. Unsicherheiten sind zumindest besser benennbar“ (Hannelore Wächtler) [3].
Inzwischen ist eine neue Ebene erreicht. Wurden in den 80er Jahren noch 2.000 doppelblind randomisierte klinische Studien, die die größtmögliche Gewähr auf Objektivität bieten, in Medline veröffentlicht, sind es inzwischen 20.000 Publikationen pro Jahr. Circa 45.000 klinische Studien laufen derzeit weltweit. Nicht wenige werden nicht auf Englisch, sondern in Mandarin publiziert. Darüber hinaus bedroht uns der sogenannte „Publication bias“. Knapp die Hälfte aller Studien, die weltweit durchgeführt werden, werden nicht veröffentlicht. Ein eindrückliches Beispiel ist eine Studie aus den 80er Jahren an 100 Patienten nach einem Herzinfarkt, die mit einem Medikament zur Behandlung von Herz-Rhythmus-Störungen versorgt wurden. In der behandelten Gruppe starben von fünfzig Patienten zehn, in der nichtbehandelten Gruppe starb lediglich ein Patient. Daraufhin verzichtete die Pharmaindustrie auf die weitere Entwicklung dieses Medikaments, leider auch auf die Veröffentlichung des Studienergebnisses. Das hat dazu geführt, dass andere Unternehmen genau diese Stoffgruppe zu Medikamenten weiterentwickelt und flächendeckend zur Anwendung gebracht hat. Erst viele Jahre später hat eine groß angelegte Studie gezeigt (CAST Studie) [vgl. 4], dass die behandelten Patienten nach einem Herzinfarkt nicht trotz der Medikation, sondern wegen der Medikation, gestorben sind. Dieses Nicht-Wissen hat zu rechnerisch sechsstelligen vermeidbaren Todesopfern pro Jahr allein in den Vereinigten Staaten von Amerika geführt.
So sind die Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen gestiegen: Der klinisch tätige Arzt ist eingeladen, sich mit den Grundlagen der evidenzbasierten Medizin zu beschäftigen, um Irrtümer und Irreführungen weitestgehend zu vermeiden. Fachgesellschaften und andere ärztliche Organisationen sind aufgefordert, ihre Leitlinien systematisch nach den Regeln der evidenzbasierten Medizin zu erstellen und in regelmäßigen Abständen anzupassen. Die Auftraggeber und die Wissenschaft sind aufgefordert, alle Studien lückenlos zu veröffentlichen und sowohl Forschern als auch der Öffentlichkeit ihre Studiendaten vollumfänglich zur Verfügung zu stellen. Eine entsprechende Richtliniengebung der Europäischen Kommission ist derzeit auf dem Weg (www.alltrials.net sei herzlich als Einstieg empfohlen, Ben Goldacre ist einfach Klasse!). Auf der politischen Ebene stellt sich die Frage, wie man systematisch die Studien sammelt, bewertet und in entsprechend handhabbarer Form Ärzten wie Patienten gleichermaßen zur Verfügung stellt. Hier ist Deutschland im Gegensatz zu den USA, Großbritannien und Norwegen noch ein „Entwicklungsland“. Das Thema bricht sich erst langsam seine Bahn. Die theoretischen Grundlagen sind vorhanden [vgl. 5].
Wenn man sich auf die befreiende Wirkung von evidenzbasierter Medizin eingelassen hat, stößt man auf die Erkenntnis, dass der Stammvater der evidenzbasierten Medizin, David Sackett, nach wie vor recht hat. Er sagt, um Patienten tatsächlich zu helfen, braucht man vier Grundvoraussetzungen:
- Ausgefeilte klinische Fähigkeiten und Erfahrungen in Anamnese und Befunderhebung, ohne die man weder die richtigen Diagnosen, noch die tatsächlichen Therapieziele aus dem Blickwinkel des Patienten definieren kann.
- Eine Praxis des lebenslangen kontinuierlichen und eigenverantwortlichen Lernens, ohne das das ärztliche Wissen in gefährlich schneller Geschwindigkeit veraltet.
- Die Tugend der Demut solle bewahrt werden, ohne diese wird man immun gegen tatsächliche Verbesserung der eigenen Fähigkeiten oder der Offenheit gegenüber Neuerungen in der Medizin.
- Man möge nie den Enthusiasmus, Arzt zu sein, und die Respektlosigkeit gegenüber althergebrachtem Wissen verlieren. Ohne diese beiden letzten Eigenschaften bringt man sich um den Spaß, den evidenzbasiertes Arbeiten tatsächlich bringt (David Sackett) [vgl. 6].
Literaturempfehlungen
- Evans I. Thornton H. Chalmers I. Glasziou P. Wo ist der Beweis? Plädoyer für eine evidenzbasierte Medizin. Bern. 2013
- Gigerenzer G. Muir Gray J. A. Bessere Ärzte, Bessere Patienten, Bessere Medizin. Berlin. 2013
- Wiesing U. Marckmann G. Freiheit und Ethos des Arztes. München 2009
- Gigerenzer G. Einmaleins der Skepsis. Über den richtigen Umgang mit Zahlen und Risiken. Berlin. 2002
Literatur
[1] Sackett D. BMJ. 1996; 312: 71-2
[2] Kunz R. Ollenschläger G. Raspe H. Jonitz G. Donner-Banzhoff N. Lehrbuch Evidenzbasierte Medizin in Klinik und Praxis. Köln. 2007
[3] Wächtler H. Begegnungen mit evidenzbasierter Medizin aus einer Landarztpraxis heraus. Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 2002, Heft 1: 62-63
[4] http://www.medlibrary.de/index.php?title=CAST-Studie
[5] Gigerenzer G. Muir Gray J.A. Bessere Ärzte, Bessere Patienten, Bessere Medizin. Berlin 2013
[6] Sackett D. Richardson et all. Evidenzbased Medicine. New York. 1977. VI-IX