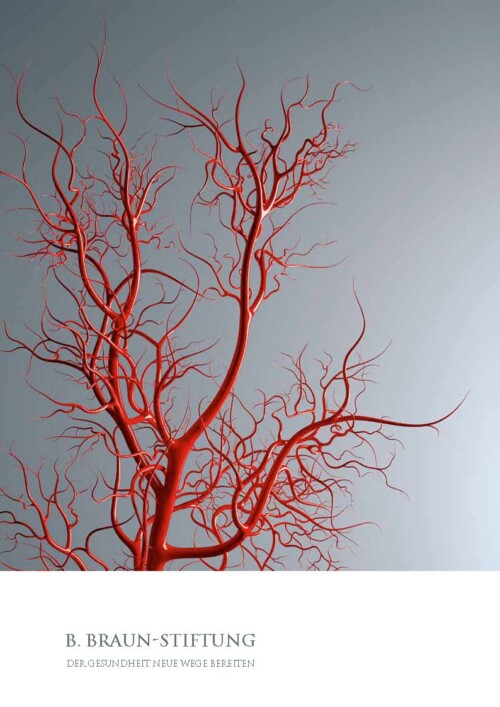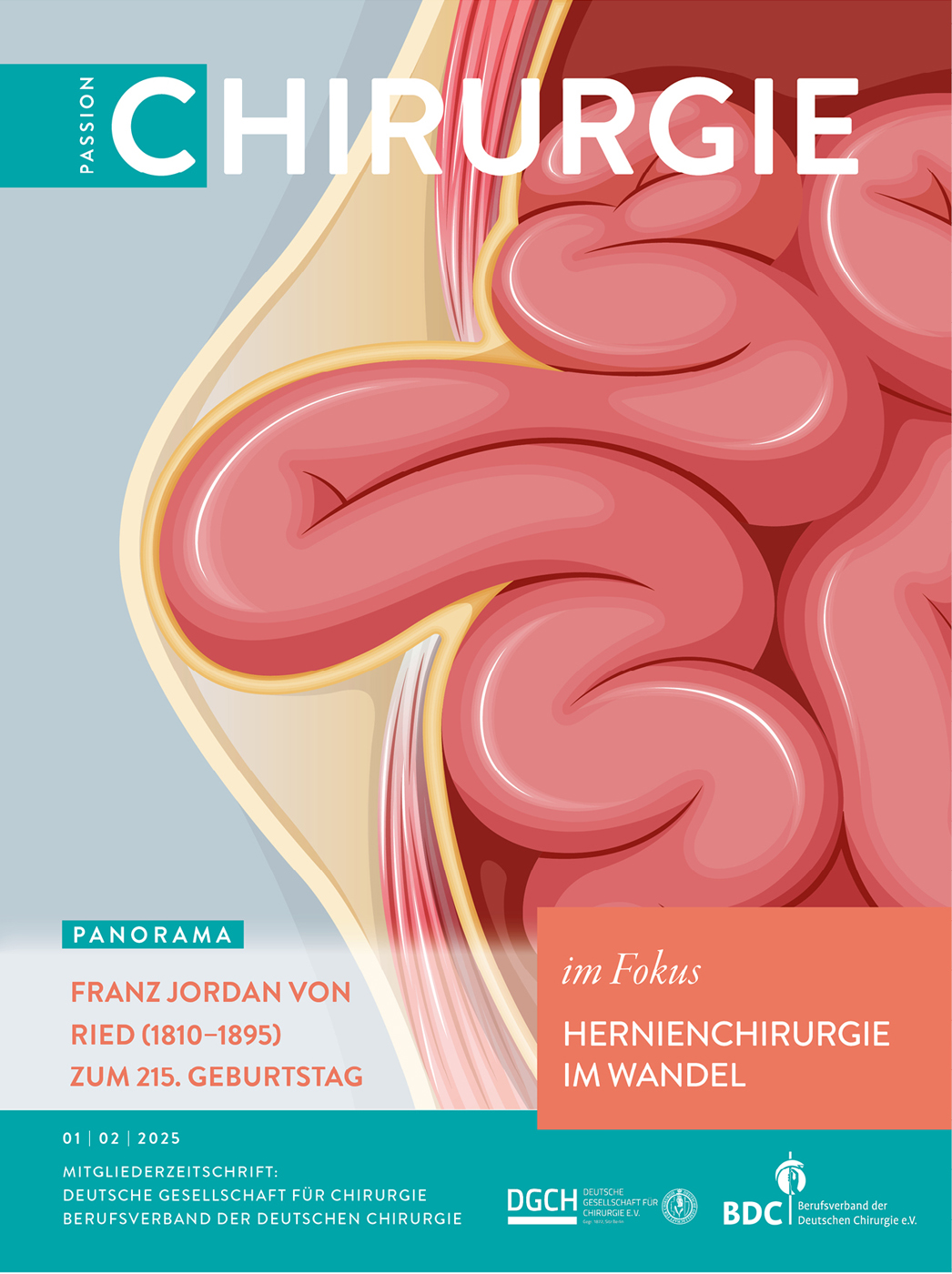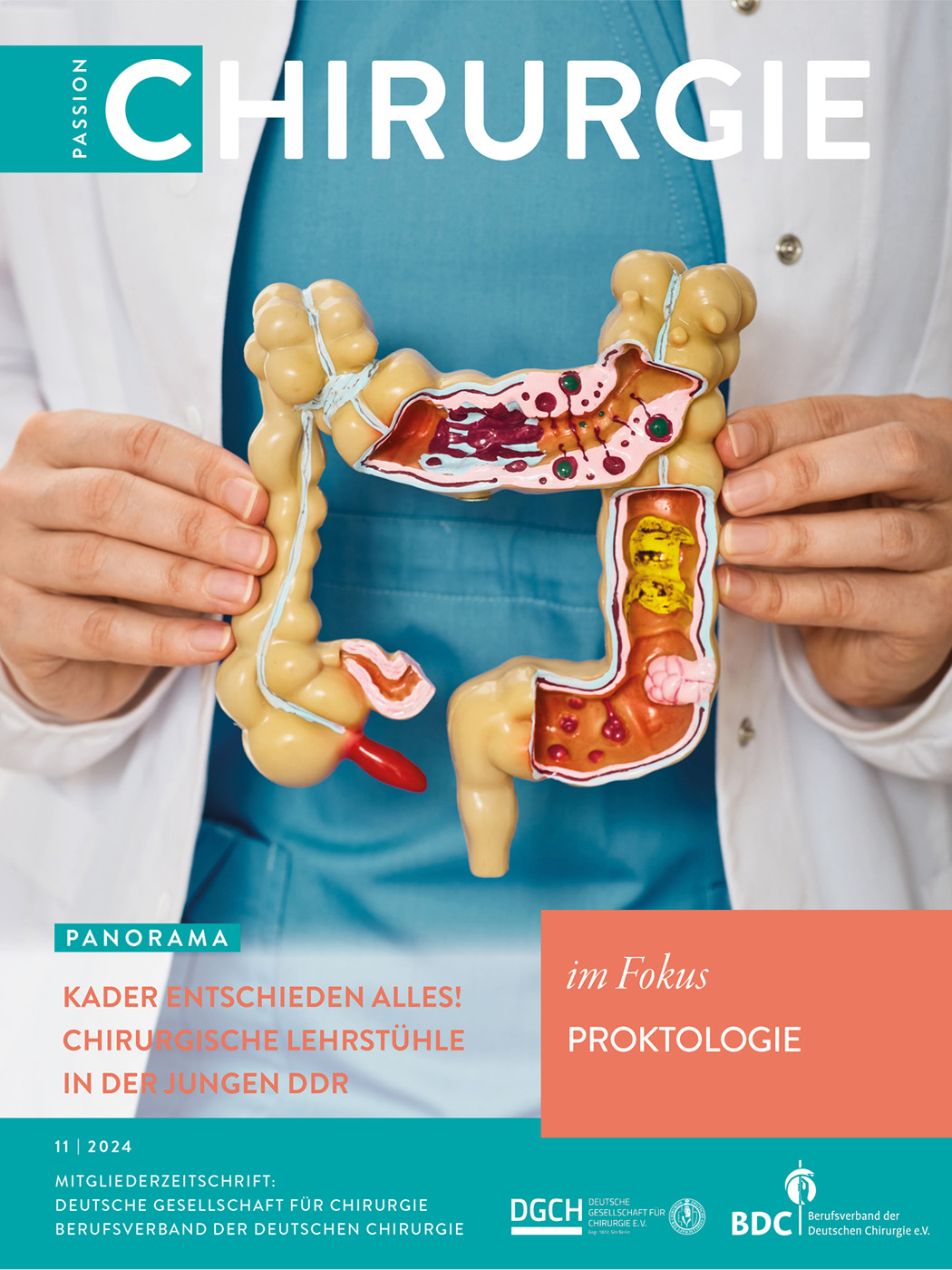01.05.2025 Fachübergreifend
Delegation von Wundmanagement an nicht-ärztliches Personal

Sowohl in Kliniken als auch bei vertragsärztlich niedergelassenen Leistungserbringern* stellt sich, insbesondere angesichts der Personalsituation und der stetig steigenden Zahl an Patienten, immer wieder die Frage der zulässigen Delegation von ärztlichen Leistungen an nicht-ärztliches Personal. In der juristischen Beratungspraxis ist dabei häufig die Delegation des Wundmanagements Gegenstand von Anfragen. Unter Wundmanagement sind dabei regelmäßig alle Tätigkeiten von der Wundanamnese, der Wundinspektion, der Wundversorgung bis hin zur Wunddokumentation zu verstehen, die durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aller an der Behandlung beteiligten Personen gekennzeichnet sind.
1. Rechtliche Grundsätze zur Delegationsfähigkeit
Bereits 1975 stellte der BGH betreffend der Pflicht des Arztes zur persönlichen Leistungserbringung folgenden Grundsatz auf: „Damit kann sich eine Pflicht des Arztes, solche Tätigkeiten im Einzelfall persönlich auszuüben, nicht schon aus der Schwere der Gefahren ergeben, die eine unsachgemäße Ausführung mit sich bringen kann. Ein persönliches Eingreifen des Arztes ist vielmehr grundsätzlich nur zu fordern, wo die betreffende Tätigkeit gerade dem Arzte eigene Kenntnisse und Kunstfertigkeiten voraussetzt (vgl. BGH, NJW 1975, 2245 f.).“
Für die Frage der Delegationsfähigkeit einer ärztlichen Leistung an nicht-ärztliches Personal kommt es somit darauf an, ob diese Leistung unter dem sog. Arztvorbehalt steht.
Eine Leistung muss nach der Rechtsprechung höchstpersönlich von einem Arzt erbracht werden, wenn diese wegen ihrer Schwierigkeit, Gefährlichkeit für den Patienten oder wegen der Unvorhersehbarkeit etwaiger Reaktionen seine spezifische ärztliche Fachkenntnis und Erfahrung erfordert. Solche dem ärztlichen Personal vorbehaltene Leistungen darf der Arzt nicht an nicht-ärztliche Mitarbeiter delegieren (vgl. Hüttl/Heberer: Physician Assistants – eine juristische Einschätzung, Passion Chirurgie, 03/2021. S. 15 ff.).
Zu den nicht delegationsfähigen ärztlichen Kernleistungen zählen nach herrschender Meinung insbesondere Anamnese, Indikationsstellung, Untersuchung des Patienten einschließlich invasiver diagnostischer Leistungen, Diagnosestellung, Aufklärung und Beratung des Patienten, Entscheidungen über die Therapie und Durchführung invasiver Therapien und operativer Eingriffe. Diese Aufzählung ist jedoch nicht als abschließend zu sehen.
Ferner zählen hierzu Tätigkeiten, für die spezialgesetzliche Arztvorbehalte festgelegt sind, wie beispielsweise für die Verschreibung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln (§ 48 AMG) oder von Betäubungsmitteln (§ 13 Abs. 1 S. 1 BtMG) sowie für die Entnahme von (Eigen-)Blutspenden (§ 7 Abs. 2 TFG).
Der Arztvorbehalt kann sich zudem aus sonstigen untergesetzlichen Regelungen, wie z. B. der G-BA-Richtlinie über die Festlegung ärztlicher Tätigkeiten zur Übertragung auf Berufsangehörige der Alten- und Krankenpflege zur selbständigen Ausübung von Heilkunde im Rahmen von Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V oder der Vereinbarung über die Delegation ärztlicher Leistungen an nicht-ärztliches Personal in der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung gemäß § 28 Abs. 1 S. 3 SGB V Anlage 24 zum Bundesmantelvertrag-Ärzte (BMV-Ä), ergeben.
Sofern kein Arztvorbehalt besteht, ist die grundsätzliche Zulässigkeit einer Delegation auch gesetzlich anerkannt. Denn gemäß § 28 Abs. 1 S. 2 SGB V umfasst die ärztliche Behandlung auch die Hilfeleistung anderer Personen, die von einem Arzt angeordnet oder von ihm zu verantworten ist.
Wundmanagement/Wundversorgung
Nach den Empfehlungen der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus dem Jahr 2008 ist die Versorgung unkomplizierter Wunden an nicht-ärztliches Personal delegierbar. Die Versorgung komplizierter und sekundär heilender Wunden ist ebenfalls an dieses delegierbar, wobei hier eine initiale und anschließend in regelmäßigen Intervallen ärztliche Überwachung gefordert wird, sodass für diese Fälle die Delegation nur nach Festlegung des patientenspezifischen Vorgehens durch einen Arzt zulässig sein soll (vgl. BÄK und KBV, Persönliche Leistungserbringung – Möglichkeiten und Grenzen der Delegation ärztlicher Leistungen, Stand 29.08.2008, abgerufen 06.03.2025).
Für die ambulante vertragsärztliche Versorgung enthält der Anhang zu Anlage 24 zum BMV-Ä einen Beispielkatalog delegierbarer ärztlicher Leistungen. Hier findet sich in Nr. 10 die Wundversorgung / Verbandwechsel. Als Besonderheiten und Hinweise sind hierzu hinterlegt, dass die initiale Wundversorgung durch den Arzt erfolgt, die weitere Wundversorgung nach Rücksprache mit dem Arzt. Als typische Mindestberufsqualifikation des nicht-ärztlichen Personals wird die der Medizinischen Fachangestellten (MFA) festgelegt, mit ggf. der Fortbildung zum Wundexperten/Wundmanager oder mit ggf. Curriculum „Ambulante Versorgung älterer Menschen“ (vgl. KBV, Anlage 24 zum BMV-Ä, abgerufen am 06.03.2025).
Gemäß der G-BA-Richtlinie zu § 63 Abs. 3c SGB V ist bei den im besonderen Teil aufgeführten ärztlichen Tätigkeiten im Rahmen von Modellvorhaben eine Übertragung auf Berufsangehörige der Kranken- und Altenpflege zur selbständigen Ausübung von Heilkunde zulässig. Die selbständige Ausübung von Heilkunde durch diese setzt danach voraus, dass die jeweils erforderliche Qualifikation gemäß § 4 Abs. 7 Krankenpflegegesetz (KrPflG) bzw. § 4 Abs. 7 Altenpflegegesetz (AltPflG) erworben wurde. Demgemäß kann sodann beispielsweise gemäß Nr. 3 bei der Diagnose „chronische Wunden z. B. Ulcus cruris“ die ärztliche Tätigkeit „Assessment Verlaufsdiagnostik“, die nach Art und Umfang die Erfassung des Wundzustands inklusive Wundgröße und Wundinfektion und pathophysiologischer Ursachen sowie relevanter Begleitparameter als auch tiefe Wundabstriche umfasst, delegiert werden.
Ebenso kann in solchen Modellvorhaben nach dieser G-BA-Richtlinie die „Umsetzung des Therapieplans (Wundmanagement)“ delegiert werden, die die Prozesssteuerung und Durchführung therapeutischer Maßnahmen umfasst:
- lokale Wundbehandlung: z. B. konservatives Vorgehen, Debridement, weitere einzuleitende Maßnahmen;
- Information, Beratung und Anleitung von Patienten und anderer am Prozess Beteiligten im persönlichen Umfeld;
- Bewertung des Behandlungsergebnisses; der Selbstmanagementfähigkeiten und Hilfebedarfe der Betroffenen insbesondere im Kontext der häuslichen Pflege-, Betreuungs- und Versorgungssituation;
- bei stationärer Versorgung in Kooperation mit dem Patienten und aller am Prozess Beteiligten frühzeitige Abstimmung des voraussichtlichen Entlassungstermins sowie die Initiierung erforderlicher nachstationärer Maßnahmen).
Als Qualifikationsanforderungen für die Delegation dieser Tätigkeit an das nicht-ärztliche Personal nach § 4 Krankenpflegegesetz bzw. Altenpflegegesetz werden festgelegt:
- Wissen um Aufgabenprofile und Aufgabenbereiche der am Wundmanagement beteiligten Akteure und Fähigkeit zur Koordination der Leistungen,
- Wissen um Grundlagen (z. B. pharmakologisch, internistisch, chirurgisch), Auswahl, Anwendung und Evaluation von heilkundlichen Interventionen,
- Wissen um Versorgungsstrukturen und -angebote für chronisch Kranke (u. a. Selbstmanagement, IV),
- Fähigkeit zu Information, Beratung und Anleitung sowie
- Wissen um die Gestaltung einer bedarfsgerechten Entlassung und deren verantwortliche Durchführung, gefordert (vgl. G-BA-Richtlinie zu § 63 Abs. 3c SGB V, abgerufen am 06.03.2025).
Aus juristischer Sicht der Autoren dürfte somit von einer grundsätzlichen Delegationsfähigkeit des Wundmanagements an hierfür qualifiziertes nicht-ärztliches Personal auszugehen sein. Die Frage der Delegationsfähigkeit einer konkreten Leistung ist aber eine stets aus medizinischer Sicht zu treffende Einzelfallentscheidung, sodass sich dies einer juristischen Beurteilung entzieht.
2. Delegationsempfänger
Kommt der behandelnde Arzt nach medizinischer Bewertung zum Ergebnis, dass es sich um eine delegationsfähige Leistung handelt, so stellen sich weitere Fragen:
- Soll die Leistung im konkreten Fall delegiert werden und wenn ja, an welchen nicht-ärztlichen Mitarbeiter darf die Leistung delegiert werden?
- Muss der betreffende nicht-ärztliche Mitarbeiter besonders angeleitet und/oder überwacht werden?
Die Beantwortung dieser Fragen muss der entscheidende Arzt stets von der Gefahrgeneigtheit der durchzuführenden Tätigkeit, der Schutzbedürftigkeit des Patienten auch unter Berücksichtigung der Komplikationsdichte und etwaigen Behandlungsschwierigkeiten sowie der Qualifikation des nicht-ärztlichen Mitarbeiters abhängig machen (vgl. Hüttl/Heberer, a. a. O.). Entscheidet er sich für eine Delegation der Leistung, so treffen ihn Auswahl-, Anordnungs-, Anleitungs- und Überwachungspflichten.
Hinsichtlich der Auswahl des Delegationsempfängers kommt es auf die Berufsqualifikation oder die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Erbringung der delegierten Leistung des Mitarbeiters an. Der Mitarbeiter muss hierfür geeignet sein.
Verfügt der nicht-ärztliche Mitarbeiter über eine abgeschlossene, ihn zu der zu delegierenden Leistung befähigenden Ausbildung in einem Fachberuf im Gesundheitswesen, so muss zunächst die formale Qualifikation anhand von Zeugnissen etc. festgestellt werden. Vor Beginn der Leistungserbringung muss sodann eine Überprüfung der tatsächlichen Qualität der von dem Mitarbeiter zu erbringenden Leistung und deren Übereinstimmung mit seiner formalen Qualifikation erfolgen. Stimmen diese überein, so reicht in der Folge eine stichprobenartige Qualitätsprüfung aus. Ergeben sich in der Leistungserbringung Abweichungen zwischen formaler Qualifikation und tatsächlicher Qualität, so müssen Nachschulungen sowie engmaschigere Kontrollen stattfinden.
Beispielsweise kann bei initialer Wundversorgung durch einen Arzt in der Regel die Delegation der weiteren Wundversorgung auf einen Physician Assistant erfolgen. Dies beinhaltet natürlich auch Verbandwechsel jeglicher Art, wobei sicherzustellen ist, dass bei auffälligen Feststellungen der Arzt hinzugezogen wird. Ebenfalls muss die Versorgung von Wunden im Sinne von Debridement etc. zulässig sein (vgl. Hüttl/Heberer, a. a. O.).
Handelt es sich hingegen um einen Mitarbeiter ohne eine abgeschlossene, die zu delegierende Leistung umfassende Ausbildung in einem Fachberuf im Gesundheitswesen, bestehen für den Arzt wesentlich mehr Pflichten. Hier muss zunächst zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Auswahlpflicht geprüft werden, ob der Mitarbeiter aufgrund seiner allgemeinen Fähigkeiten überhaupt für eine Delegation der konkreten Leistung geeignet ist. Wird die Eignung bejaht, so muss der Arzt seine Anleitungspflicht erfüllen, indem er den Mitarbeiter zur eigenständigen Durchführung der Leistung anlernt. Auch wenn der Mitarbeiter die Leistung sodann beherrscht, musst er diesen dennoch zunächst regelmäßig überwachen. Eine stichprobenartige Überprüfung wird grundsätzlich erst nach einer gewissen Zeit möglich sein, wobei es hier keine festgelegten Grenzen gibt, da dies auf die jeweiligen Einzelfallumstände ankommt (s. zu Vorstehendem BÄK und KBV, Persönliche Leistungserbringung – Möglichkeiten und Grenzen der Delegation ärztlicher Leistungen, Stand 29.08.2008, a. a. O.).
Erfüllt der jeweilige Mitarbeiter nicht diese Qualifikationsanforderungen an eine zulässige Delegation, so ist von einer Delegation zwingend abzusehen.
3. Verantwortlichkeiten und Haftung
Der delegierende Arzt ist für die ordnungsgemäße Auswahl, Anordnung, Anleitung und Überwachung des nicht-ärztlichen Mitarbeiters verantwortlich. Je höher die fachliche Qualifikation und tatsächlichen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Kenntnisse des Mitarbeiters, umso geringer werden lediglich die Überwachungspflichten des Arztes. Im Rahmen der Delegation an nicht-ärztliche Mitarbeiter besteht zudem regelmäßig die Verpflichtung des Arztes zum Aufenthalt in unmittelbarer Nähe (Rufweite). Verletzt er eine dieser Pflichten schuldhaft und verursacht dies einen Patientenschaden, so ist er haftbar.
Lediglich der Vollständigkeit halber wird erwähnt, dass selbstverständlich auch die Einwilligung des Patienten zur Delegation der ärztlichen Leistung auf nicht-ärztliches Personal vorliegen muss, damit diese zulässig ist.
Führt eine schuldhafte Pflichtverletzung des nicht-ärztlichen Mitarbeiters zu einem Patientenschaden, so haftet auch hierfür der delegierende Arzt. Im Krankenhaus haftet zudem der Krankenhausträger. Aufgrund des rechtlichen Umstandes, dass die delegierte Leistung dem Arzt als eigene zugerechnet wird, verbleibt auch bei zulässiger Delegation die haftungsrechtliche Gesamtverantwortung stets beim delegierenden Arzt.
Dem nicht-ärztlichen Mitarbeiter kommt zum einen die sog. Remonstrationspflicht zu, d. h. er muss dem Arzt seine Bedenken hinsichtlich der Rechtmäßigkeit der Delegation mitteilen, wenn er der Ansicht ist, dass er die Leistung nicht erbringen kann oder darf. Zum anderen trägt der Mitarbeiter selbstverständlich die Übernahme- und Durchführungsverantwortung, d. h. wenn er eine auf ihn zulässig delegierte Leistung übernommen hat, haftet er für deren lege artis Durchführung. Treten Komplikationen auf, so ist der Mitarbeiter zudem zur unmittelbaren Hinzuziehung des Arztes verpflichtet. Verletzungen dieser Pflichten führen zur unmittelbaren Haftung des nicht-ärztlichen Mitarbeiters im Falle eines Patientenschadens (vgl. Hüttl/Heberer, a. a. O.).
Stellungnahme
Nachdem juristisch lediglich der Rahmen für eine zulässige Delegation vorgegeben ist, bestehen in der Praxis immer wieder Schwierigkeiten diesen mit konkret zulässigen Leistungen auszufüllen.
Den bestehenden Handlungsbedarf zur Konkretisierung delegationsfähiger Leistungen hat auch der Gesetzgeber gesehen. Insbesondere die bereits im Vertragsarztrecht geltenden Regelungen des § 37 Abs. 7 SGB V i. V. m. den Rahmenempfehlungen gemäß § 132a Abs. 1 SGB V, der G-BA-Richtlinie über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege, der G-BA-Richtlinie zu § 63 Abs. 3c SGB V sowie Anlage 24 zum BMV-Ä sehen hier eine Übertragung von Tätigkeiten im Rahmen der Wundversorgung bzw. des Wundmanagements auf nicht-ärztliches Fachpersonal vor.
Auch wenn es sich hierbei um Rechtsgrundlagen aus dem GKV-Bereich handelt, kann dies nach Meinung der Autoren nicht zu einer ausschließlichen Beschränkung hierauf führen. Denn insbesondere wird aus der Gesetzesbegründung zum Modellvorhaben nach § 63 Abs. 3 c SGB V deutlich, dass berufsrechtlich die zusätzlich erworbenen Kompetenzen nicht auf Tätigkeiten im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung beschränkbar sind, da die Ausbildung eine grundlegende Kompetenz vermittelt, die generell und dauerhaft den Zugang zum erlernten Beruf und damit die Ausübung der erlernten heilkundlichen Tätigkeit gestattet (vgl. Hüttl/Heberer, a. a. O.). Hieraus lässt sich aus Sicht der Autoren also folgern, dass eine grundlegend erworbene Kompetenz zur generellen und dauerhaften Ausübung berechtigt.
Des Weiteren sieht der noch vom alten Bundeskabinett der Ampelkoalition am 18.12.2024 beschlossene Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Pflegekompetenz (Pflegekompetenzgesetz) konkret weitere eigenverantwortlich zu erbringende Tätigkeiten durch Pflegefachkräfte insbesondere auch beim Wundmanagement vor. Ob dieser Gesetzentwurf nun aber tatsächlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.
Im Übrigen ist bei der Füllung des Rahmens auch die Rechtsprechung zur Delegation sowie die Entwicklung der Berufsbilder und Qualifikationen nicht-ärztlichen Fachpersonals zu beachten. Beispielsweise sieht das Pflegestudium-Stärkungsgesetz (PfStudStG) seit 01.01.2025 eine Ergänzung des Pflegestudiums in Bezug auf die erweiterte heilkundliche Verantwortung für Pflege- und Therapieprozesse mit Menschen aller Altersstufen, die von chronischen Wunden betroffen sind, vor (vgl. Anlage 5 Abschnitt B III. Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung).
Das Wundmanagement ist nach Einschätzung der Autoren eine grundsätzlich delegationsfähige Leistung und kann jedenfalls an nicht-ärztliches qualifiziertes Fachpersonal des Gesundheitswesens delegiert werden. Die Frage der Delegation ist zusammenfassend aber stets im Rahmen einer medizinischen Einzelfallbetrachtung vor allem nach der Überschaubarkeit bzw. Schwere der Behandlungsmaßnahme und der Qualifikation des Mitarbeiters zu treffen. Die Gefährdung des Patienten bestimmt hier in jedem Einzelfall das Maß der objektivierten und erforderlichen Sorgfaltspflichten des Arztes. Eine Beeinträchtigung der Versorgungsqualität und der Patientensicherheit muss in jedem Falle ausgeschlossen werden.
Heberer J, Bäuml N: Delegation von Wundmanagement an nicht-ärztliches Personal. Passion Chirurgie. 2025 Mai; 15(05): Artikel 03_03.
*Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Artikel das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten immer für alle Geschlechter.
Autor:innen des Artikels
Weitere aktuelle Artikel
01.05.2025 BDC|News
SURGEON TALK PODCAST: Wundmanagement NEU gedacht!
Wenn ein Thema in die Chirurgie gehört und chirurgischer nicht sein kann, dann alles rund um das Wundmanagement. Was zunächst selbstverständlich klingt, erweist sich spätestens beim zweiten Blick als komplexes Thema.
16.04.2025 BDC|News
DCK Kompakt 2025: Podcast von Surgeon Talk
DCK Kompakt als Podcast. Das Surgeon Talk Team hat die #hot#topics des Deutschen Chirurgie Kongress eingefangen. Kurzweilig, prägnant und unterhaltsam.
21.02.2025 Aus-, Weiter- & Fortbildung
Braun-Stiftung schüttet Fördergelder für Stipendien und Forschung aus
Die B. Braun-Stiftung fördert auch dieses Jahr wieder Menschen im Gesundheitswesen im Rahmen ihrer beruflichen Entwicklung mit Stipendien und stellt Fördergelder für die Forschung und Veranstaltungen bereit. Zudem schreibt die Stiftung wie die Jahre zuvor einen Forschungsschwerpunkt aus.
01.12.2024 Fachübergreifend
Das TraumaRegister DGU® der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie – die Erfolgsgeschichte ist jetzt Ü30
Als ein zentrales Instrument der Versorgungsforschung dienen medizinische Register dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn und stellen ein wertvolles Werkzeug zur medizinischen Qualitätssicherung dar. Die strukturierte, plausibilitätsgeprüfte Erfassung einer großen Anzahl von Patientenfällen auf einer longitudinal ausgerichteten Zeitachse mit unterschiedlichen Zeitpunkten der Datenerhebung lassen Aussagen zu zahlreichen relevanten Outcomes – nicht nur der Mortalität von Patienten – zu.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.