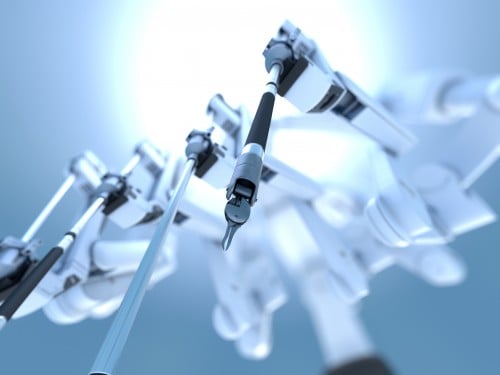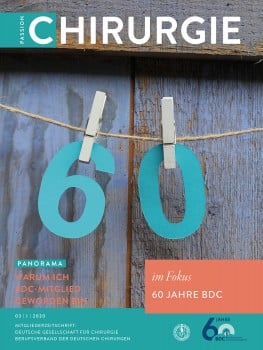09.04.2020 Politik
Das Krankenhaus steht für gute Notfallversorgung

Statistisch gesehen ist fast jeder vierte Deutsche einmal im Jahr ein Notfallpatient. Rund 20 Millionen Fälle, in denen Menschen schnelle medizinische Hilfe suchen, verzeichnet die Buchführung jährlich. Mit 10,5 Millionen Fällen versorgen die Krankenhäuser den größten Teil. Dass diese Patienten nicht immer nur mit lebensbedrohlichen Beschwerden in den Notaufnahmen behandelt werden, ist allgemein bekannt. Aber die meisten dieser Patienten suchen die Notaufnahmen nicht aus Bequemlichkeit auf, sondern weil sie im niedergelassenen Sektor keine Hilfe gefunden haben. Das Empfinden, ab wann eine Erkrankung ein tatsächlicher Notfall ist, ist äußerst subjektiv. Wenn die Rettungsleitstellen hier zukünftig die Patienten fachlich beraten und damit einen Beitrag zur Steuerung leisten, ist das zu begrüßen. Wer medizinische Hilfe benötigt, sucht nicht lange nach Bereitschaftsdiensten oder wartet auf den mobilen Bereitschaftsarzt. Er geht ins Krankenhaus, wo er umfassende und kompetente Versorgung erwartet und auch bekommt.
Die Politik hat die Realitäten des Patientenverhaltens erkannt und richtet die Reform der Notfallversorgung darauf aus. Das zumindest lassen die bisherigen Verlautbarungen aus dem Gesundheitsministerium erahnen. Die derzeitige Struktur, wonach die Notfallversorgung primär in der Hand der Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) lag, hat sich in der Wirklichkeit nicht bewährt. Das mag einerseits an mangelnder Kenntnis dieses Angebots bei den Patienten liegen, andererseits schlicht an unzureichenden Strukturen: Notfallpraxen sind für viele Menschen schwer erreichbar und nur eingeschränkt in ihrer Leistungsfähigkeit. Die Wahrscheinlichkeit, aufgrund einer schwereren Erkrankung ohnehin in ein Krankenhaus gebracht zu werden, ist immer gegeben. Viele Patienten nehmen unter diesen Bedingungen gleich den direkten Weg in die Notfallambulanzen der Krankenhäuser. Auch weil sie um das breitere Angebot an Fachärzten in den Kliniken wissen.
 Krankenhäuser benötigen keine Aufpasser
Krankenhäuser benötigen keine Aufpasser
In den vergangenen Jahrzehnten haben die Krankenhäuser unzweifelhaft bewiesen, dass sie Notfallversorgung können wie kein anderer Akteur des Gesundheitswesens. Umso befremdlicher erscheint die Absicht, die geplanten Integrierten Notfallzentren (INZ) an den Krankenhäusern unter die fachliche Leitung der KVen stellen zu wollen. Die KVen sind jedoch keine Leistungserbringer, sondern verantwortlich für die Rahmenbedingungen im niedergelassenen Bereich. In diesem Sinne sind sie besser beraten, die Organisation der niedergelassenen Notfallstrukturen zu übernehmen, statt in die Arbeit der Krankenhäuser hineinzuwirken. Denn für die Patienten ergibt sich keine Verbesserung, wenn mit den INZ faktisch ein weiterer Sektor als wirtschaftlich unabhängige Einrichtung im Krankenhaus aufgebaut wird. Im Gegenteil, es dürfte noch mehr Verwirrung stiften.
Hintergrund dieses Konzepts sei es, Fehlanreize in den Krankenhäusern zu vermeiden, so die Begründung. Klar gesprochen: Den Krankenhäusern wird erneut vorgeworfen, Patienten ohne triftigen Grund zu behandeln, oder sie gar in die Notaufnahmen zu drängen. Da natürlich ein Teil der Notfallpatienten zur Weiterbehandlung auf die Stationen verlegt wird, schwebt auch der ständige Vorwurf im Raum, die Notfallversorgung diene lediglich der Patientenakquise.
Patienten, Ärzte und Pflegekräfte wissen angesichts des Alltags in den oft überfüllten Notaufnahmen um die Absurdität dieser Behauptung. Patienten kommen nicht in Notaufnahmen, weil sie von den Krankenhäusern auf den Marktplätzen eingesammelt werden, sondern weil sie an anderer Stelle keine Hilfe erhalten oder die größtmögliche medizinische Kompetenz einfach in einem Krankenhaus erwarten. Der Vorschlag, dass die KVen die INZ betreiben, mag ein letztes Festhalten an der alten Prämisse sein, wonach der niedergelassene Sektor die Verantwortung für die Notfallversorgung trägt. Dass das aber vielerorts nicht funktioniert, spüren Patienten und Krankenhäuser allerdings seit vielen Jahren. Gegen Kooperationen ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil, eine gute medizinische Versorgung, nicht nur im Notfall, benötigt leicht überwindbare Sektorengrenzen und möglichst viele Kooperation.
Völlig verantwortungslos ist das Ansinnen der Politik dagegen, den Krankenhäusern, denen kein INZ von Kassen und KV zugesprochen wird, die Notfallvergütung um 50 Prozent zu kürzen. Patienten, die in einer Notfallsituation ins nächstgelegene Krankenhaus kommen, müssen sich darauf verlassen können, dass vor Ort die notwendigen Fachärzte – also vor allem Chirurgen – auch kurzfristig zur Verfügung stehen. Das bedeutet Vorhaltekosten für die Krankenhäuser.
Sektorenübergreifende Gesundheitszentren sichern Versorgung in der Fläche
Unser Vorschlag zur Sicherung – nicht nur – der Notfallversorgung sind sektorenübergreifende Gesundheitszentren. Vor allem in ländlichen Regionen bricht der niedergelassene Sektor zunehmend weg. Es liegt nahe, die vorhandenen Krankenhäuser zu Gesundheitszentren auszubauen, die neben der stationären auch eine ambulante Versorgung bieten und Notfallpatienten rund um die Uhr betreuen. Damit ließen sich die größer werdenden Lücken schließen und die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen entlasten. Die sektorenübergreifende Struktur sichert zudem durch die kollegiale Zusammenarbeit die medizinische Qualität. Gerade in ländlichen Gegenden, in denen Krankenhäuser schon heute Leuchttürme der medizinischen Versorgung sind, könnten solche Gesundheitszentren weitere Vorteile haben. Mit ihrem vielfältigen Arbeitsplatzangebot sichern sie die Attraktivität der Regionen und bieten auch für Hochqualifizierte Gründe, nicht in Großstädte abzuwandern. Gesundheitszentren würden durch ihr breiteres Angebot noch stärker als ländliche Krankenhäuser als „Brutstätte“ künftiger Haus- und niedergelassener Fachärzte dienen, die gerade in Dörfern und Kleinstädten dringend benötigt werden. Um solche Strukturen zu schaffen, müssen allerdings die Entscheidungswege geändert werden. Die Entscheidungsmacht, ob Krankenhäuser auch ambulante Leistungen erbringen dürfen, darf natürlich nicht länger in den Händen derjenigen liegen, für die solche Angebote eine wirtschaftliche Konkurrenz darstellen.
Von einer Reform der Notfallversorgung erwartet sich die Deutsche Krankenhausgesellschaft also grundsätzliche Veränderungen, die auf das veränderte Patientenverhalten und auf die Herausforderungen für Ärzte und Krankenhausorganisation Rücksicht nehmen. Entscheidend wird sein, dass diese Reform nicht von Partikularinteressen und altem Besitzstandsdenken geprägt ist.
Diesen Beitrag haben wir für die BDC-Jubiläumsausgabe angefragt und freuen uns sehr, dass Herr Dr. Gaß von der Deutschen Krankenhausgesellschaft die Zeit gefunden hat, eine Würdigung zu schreiben.
Gaß G: Das Krankenhaus steht für gute Notfallversorgung. Passion Chirurgie. 2020 März, 10(03): Artikel 03_04.
Autor:in des Artikels
Weitere aktuelle Artikel
24.05.2018 Kinderchirurgie
Kleinkinder sind Hochrisikogruppe bei Brandverletzungen
Jährlich werden deutschlandweit über 30.000 Kinder mit thermischen Verletzungen ambulant und 6.000 Kinder stationär behandelt. Verbrühungen, Feuer und Flammen, Kontaktverbrennungen, Strom sowie Verpuffung und Explosion führen zu gesundheitlichen Schäden mit oft lebenslanger Beeinträchtigung. Der Unfallschwerpunkt liegt klar im häuslichen Umfeld. Eine Auswertung des Arbeitskreises „Das schwerbrandverletzte Kind“ zeigt, dass Säuglinge und Kleinkinder eine Hochrisikogruppe darstellen.
22.05.2018 Pressemitteilungen
Nur Mut: Robotik zum Mitmachen in Erlangen
Am 26. Mai 2018 kommen 40 Medizinstudierende nach Erlangen zum Workshop „Chirurgie zum Mitmachen“. Zum ersten Mal werden Studierende im Rahmen der bundesweiten Workshop-Reihe die Möglichkeit haben, sich auch am OP-Roboter zu üben. Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) veranstaltet den eintägigen Workshop gemeinsam mit der Chirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen unter der Leitung von Prof. Dr. med. Stephan Kersting.
21.05.2018 Politik
Zi veröffentlicht Umfrageergebnisse
Etwa jedes dritte (32 Prozent) Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) musste im Jahr 2016 finanzielle Verluste hinnehmen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuell veröffentlichte Untersuchung des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung (Zi).
17.05.2018 Politik
„Wir brauchen Klarheit, Herr Minister!“
Telematikinfrastruktur – Mitten im technischen Rollout scheint die Politik das Projekt elektronische Gesundheitskarte plötzlich generell in Frage zu stellen. Gelten bestehende Gesetze nun nicht mehr? KBV-Chef Dr. Andreas Gassen fordert Klarheit.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.