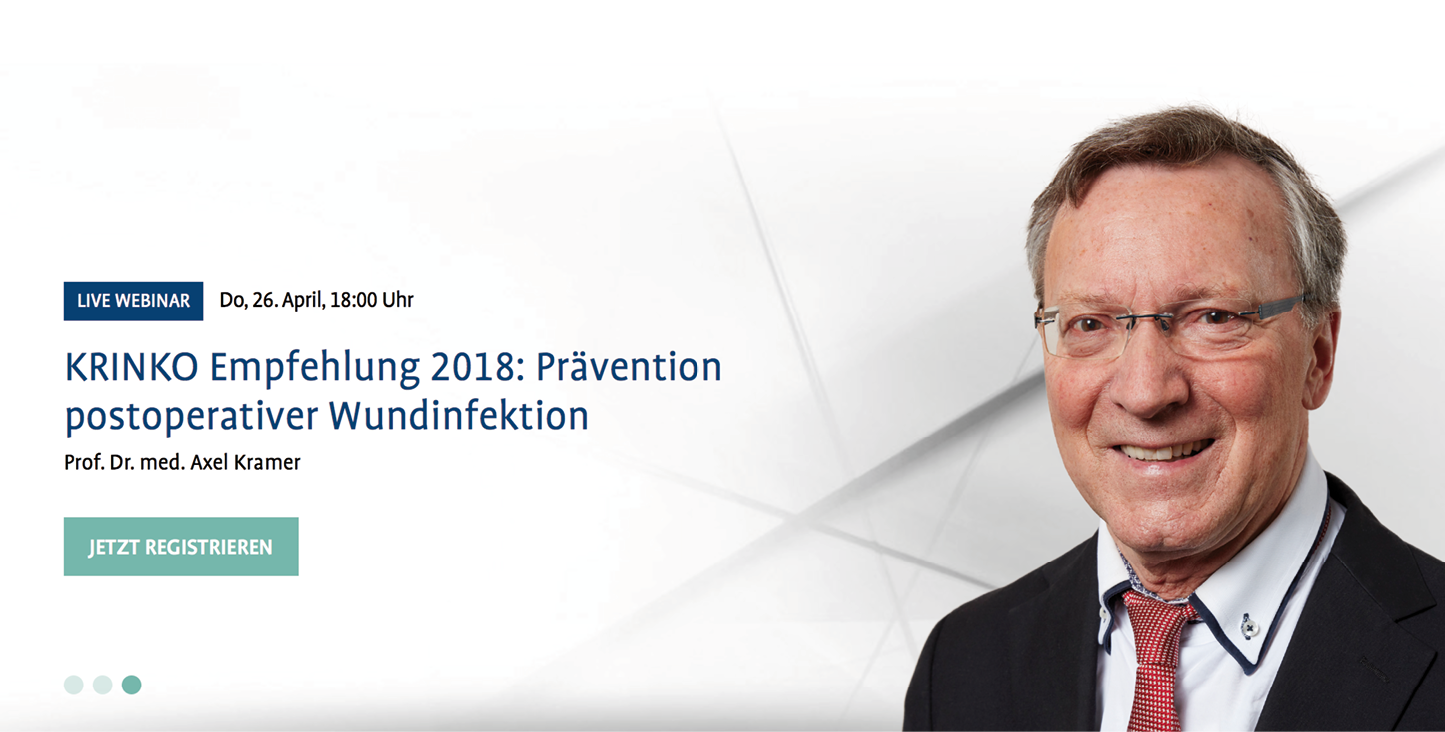Zur Erinnerung an das Schicksal jüdischer Ärzte während des Nationalsozialismus haben die Vertreter chirurgischer Fachgesellschaften am Haus der Chirurgie in Berlin im Februar 2018 einen Gedenkstein errichtet. Im Folgenden drucken wir die zwei Redemanuskripte ab, die anlässlich der Einweihung des Gedenksteines gehalten wurden.
Rede von Prof. Dr. med. Jörg Fuchs, Präsident der DGCH 2017/2018
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie wurde 1872 auf Initiative der Herren Bernhard von Langenbeck, Gustav Simon und Richard von Volkmann gegründet.
Gemäß dem Eid des Hippokrates sollte die chirurgische Wissenschaft und Nachwuchsförderung zur Weiterentwicklung des Faches Chirurgie und zum Wohle des Patienten dienen. In vielen Bereichen unserer Profession gab es wahrhaftige Pioniere und historische Vorbilder.
Ich zitiere in diesem Zusammenhang Theodor Billroth, Mitglied des Gründungsausschusses: „Was mir am meisten Freude in meinem reichen Leben gemacht hat, ist die Begründung einer Schule, welche sowohl in wissenschaftlicher wie in humanitärer Richtung mein Streben fortsetzt und ihm dadurch etwas von Dauer verschafft.“
Deutschland erlebte von 1933 bis 1945 das dunkelste Kapitel seiner Geschichte und auch innerhalb unserer Fachgesellschaft kam es vielfach zu einer Abkehr von bisherigen Wertevorstellungen. Die Chirurgie machte hier sowohl in berufspolitischer als auch in wissenschaftlicher Hinsicht mit unfassbaren Human-Experimenten keine Ausnahme. Diese Zeit war geprägt durch eine gnadenlose Ausgrenzung, Entwürdigung und Verfolgung von jüdischen Mitmenschen und endete in Krieg und organisierter Massenvernichtung. Nach Kriegsende existierte eine tiefe Identitätskrise und kollegiales Schweigen. Jahre der Ohnmacht folgten. Aufarbeitungen und Analysen zu den Geschehnissen dieser Zeit gestalteten sich als außerordentlich herausfordernd.
Die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie setzte 2011 mit dem ersten Band „Deutsche Gesellschaft für Chirurgie 1933-1945 – die Präsidenten“ ein Zeichen zur Aufarbeitung von Unrecht und Verbrechen an 217 jüdischen Mitgliedern der Gesellschaft während des Dritten Reiches. In einer weiteren intensiven Nachlese sind es im bald erscheinenden zweiten Band nun mehr als 315 verfolgte jüdische Kolleginnen und Kollegen, denen unser Gedenken gilt. Sie alle wurden in der Zeit des Nationalsozialismus gedemütigt, entrechtet, mussten ins Ausland fliehen oder wurden gemeinsam mit Ihren Familien in Konzentrationslager verschleppt und teils in den Tod getrieben.
Auf Initiative der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V. errichtet die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie e.V. und die mit ihr verbundenen zehn chirurgischen Fachgesellschaften einen Gedenkstein. Der zwei Meter große Monolith aus der Bretagne findet seinen Platz hier im Garten des Langenbeck-Virchow-Hauses, dem Haus – unserem Haus – der Chirurgie. Zusammen mit einer Gedenktafel soll er am historischen Ort der Gründung unserer Gesellschaft ein Zeichen der Verantwortung gegen das Vergessen setzen.
Mit der Einweihung dieses Gedenksteines möchten wir heute gemeinsam in Demut und Ehrfurcht unserer damals verfolgten Kolleginnen und Kollegen und aller jüdischen Mitglieder gedenken, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Wir sind es ihnen schuldig an das unermessliche Leid, das sie erfahren mussten, zu erinnern.
Prof. Dr. med. Jörg Fuchs Präsident der DGCH 2017/2018
Rede von Prof. Dr. med Hans Zwipp, Sprecher der DGU-Senatoren
Verehrte Kollegen,
da der Stein des Gedenkens noch im ausklingenden Duemillenium des Poeten Ovid hier im Garten des Langenbeck-Virchow-Hauses am 13.12.2017 aufgestellt wurde, möchte ich auf dreierlei Metamorphosen eingehen.
Die 1. Metamorphose ist die Verwandlung einer Idee zum sichtbaren Stein.
Vor gut einem Jahr wollten die Senatoren der Unfallchirurgie neben den sichtbaren Stolpersteinen in Leipzig, auch hier in Berlin, im Haus der Chirurgie ein sichtbares Zeichen der Erinnerung, der Wertschätzung und des Mahnens setzen. Aus der Idee Stele von Lothar Kinzl, initial ein Projekt der DGU-Senatoren, wurde es im Diskurs eines Jahres auch ein Projekt der DGCH und zuletzt sogar eines aller zehn chirurgischen Fachgesellschaften. Deshalb erinnern heute mit diesem Mahnmal mehrere Tausend Mitglieder der zehn chirurgischen Fachgesellschaften Deutschlands an ihre mehrere Hundert früheren jüdischen Mitglieder. Wir gedenken ihrer in ihrer Gesamtheit, dies bewusst ohne Namen zu nennen, da etliche noch nicht gefunden, kriegsbedingt verlorengegangen, vielleicht nie wieder zu finden sind.
Die 2. Metamorphose ist die petrologische, die Entstehung dieses Steines.
Er ist ein rot-bunter, unbehauener Schiefer, 2 m groß, 600 kg schwer, der geochronologisch im Devon, d.h. vor etwa 350 Millionen Jahren als Sedimentstein entstanden ist: aus Peliten, d. h. kleinsten Schlamm-Schotter-Sandkörnern, aus Quarz- und Feldspat-Mineralien, Kaolinit u. a. Substraten, die über Flüsse in ein Meerbecken transportiert wurden, dort langsam sinterten und mit zunehmendem Gewicht zu Tonstein kompaktierten. Durch weitere Überlagerung in etwa 7.000 m Versenkungstiefe wurde unter hohem Druck und hoher Temperatur aus dem Tonstein in seiner Metamorphose Schiefer. Sein roter Anteil ist durch Eisenerde bedingt. In seiner schönen Form und Farbe kam er vermutlich in der Jungsteinzeit, vor etwa 7.000 Jahren in Saint Just zum Vorschein. Ein Ort in der heutigen Bretagne, wo es nach Carnac die meisten Menhire Frankreichs gibt. Seinen Weg hierher an diesen Ort hat er über Belgien genommen, um ein Stein des Erinnerns zu werden.
Die 3. Metamorphose ist die mythologische Verwandlung Mensch zu Stein.
Ich erinnere an Battus, der von Merkur wegen Meineids in einen Stein verwandelt wurde, an Lichas, der zum Felsen wurde, als er unwissend Herakles das vergiftete Hemd überbrachte und an Niobe, die sich gegenüber der Titanin Leto vermaß, sodass sie alle ihre Kinder verlor und in Trauer zum Stein erstarrte, der nicht aufhörte, Tränen zu vergießen. Mit diesen Metaphern der versteinernden Schuld, „ist es gerade in der heutigen Zeit wichtig, dass sich Deutschlands Chirurgen nach so langen Jahren des Unrechts und der Verbrechen zu ihren früheren jüdischen Mitgliedern öffentlich bekennen“.
Prof. Dr. med. Hans Zwipp Sprecher der DGU-Senatoren