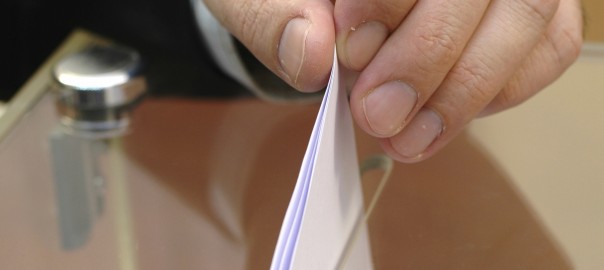VKD kritisiert Zwangsrabatte, präferiert Strukturveränderungen mit Augenmaß und plädiert für Neustart der Bund-Länder-AG
Dreht die Politik an den falschen Stellschrauben? Trotz einer ganzen Reihe von durchaus sinnvollen gesetzlichen Neuregelungen geht es vielen Krankenhäusern wirtschaftlich immer schlechter. Die Folgen dieses Finanzmangels sind gravierend und betreffen die notwendigen Strukturveränderungen ebenso wie die schleppende Digitalisierung und auch den Fachkräftemangel. „Das ist sicher für viele eine unbequeme Wahrheit, die aber mit Blick auf die konkreten Zahlen eindeutig belegbar ist“, erklärt der Präsident des Verbandes der Krankenhausdirektoren Deutschlands (VKD), Dr. Josef Düllings. Im Vorfeld der am 9. Mai in Berlin beginnenden Jahrestagung des Verbandes analysiert der Verbandschef wesentliche Gründe für die aktuell schlechte Situation vieler Kliniken.
„Wir agieren derzeit in einem Rechtsgefüge mit diversen Rabattstaffeln“, so Dr. Düllings. „Die Rabatte werden aber nicht freiwillig von den Krankenhäusern angeboten, wie es im Wettbewerb üblich ist, sondern vom Gesetzgeber auf Bundes- und Landesebene, von der Selbstverwaltung auf Bundes- und Landesebene sowie von den Krankenkassen vor Ort den Krankenhäusern vorgeschrieben oder aufgezwungen.“ Kein Krankenhaus könne ihnen entgehen.
Rabatt Nummer 1: Fallpauschalen sorgen systemisch für Defizite
Der erste Rabatt ist systembedingt in den Fallpauschalen enthalten. Er wird vor allem von den Krankenhäusern der Grundversorgung unfreiwillig gewährt – das betrifft rund 700 Kliniken. Die Fallpauschalen beruhen auf einer Durchschnittskalkulation. Der hier enthaltene durchschnittliche Anteil der Fixkosten ist niedriger als die tatsächlich von diesen Kliniken zu zahlenden Kosten. Daraus ergibt sich in jedem abgerechneten Behandlungsfall ein Defizit, das sich natürlich aufsummiert und schließlich zur Insolvenz führen kann. Adressaten für diese Schieflage sind der Gesetzgeber und die Selbstverwaltung auf Bundesebene.
Rabatt Nummer 2: Landesbasisfallwerte vergrößern die Preis-Tarif-Schere
Den zweiten Rabatt zahlen alle Krankenhäuser über den auf Landesebene festgelegten Landesbasisfallwert. Seit Jahren liegen dadurch die Preise für Krankenhausleistungen unter den allgemeinen Kosten, vor allem aber unter den stetig steigenden Personalkosten. Das konnte in der Vergangenheit vielfach durch Mehrleistungen kompensiert werden. Das Ende der Fahnenstange ist hier aber erreicht. Diese Rabattierung verhandeln die Partner der Selbstverwaltung auf Landesebene.
Rabatt Nummer 3: Leistungsfähigkeit wird bestraft
Eine enorme Rabattstaffel, wie sie in dieser Höhe wohl in keiner anderen Branche üblich ist, trifft vor allem die besonders leistungsfähigen Krankenhäuser. Sie müssen einen Abschlag von 35 Prozent (Fixkostendegressionsabschlag) für mit den Krankenkassen vereinbarte Mehrleistungen hinnehmen. Und nicht nur das: Bei ungeplanten Mehrleistungen zahlen sie sage und schreibe 65 Prozent an Mehrerlösausgleichen an die Krankenkassen zurück. Mehr Leistungen – weniger Geld. Von diesen Rabatten profitieren die Krankenkassen.
Rabatt Nummer 4: Rückholaktion: Geleistet, aber nicht bezahlt
Diese Rabattstaffel hat derzeit Hochkonjunktur. Sie ist für einige Krankenkassen zu einem neuen Geschäftsmodell geworden. Aktuell werden Studien zufolge etwa zwei Milliarden Euro in den ohnehin übervollen Geldtopf der Kassen zurückgeholt, obwohl nachweislich 96 Prozent aller Krankenhausrechnungen korrekt sind. Es geht also nicht, wie von den Kassen gern behauptet, um Falschabrechnungen oder falsche Kodierungen. Es geht aus Sicht des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) um falsche Versorgungsformen oder auch sogenannte Fehlbelegungen. Das sind zum Beispiel Leistungen, bei denen eine Anschlussversorgung im ambulanten Bereich nicht sofort zur Verfügung steht. Akuter Pflegepersonalmangel herrscht ja auch dort. Hier leistet das Krankenhaus dann ersatzweise diese Pflege – und wird dafür nicht bezahlt. Diese MDK-Zwangsrabattierung nimmt zu und ist inzwischen das größte Risiko für die Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern.
Rabatt Nummer 5: Investitionsförderung sträflich niedrig
Negativ auf die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser wirkt sich nach wie vor die sträflich niedrige Investitionsförderung durch die Länder aus. Anfang der neunziger Jahre noch bei neun Prozent, ist sie aktuell bei drei Prozent – ein von Jahr zu Jahr negatives Delta von sechs Prozent, das nicht kompensierbar ist. Die Krankenhäuser geben hier also den Ländern einen Zwangsrabatt und vergrößern damit die Gefahr, notwendige Investitionen nicht vornehmen zu können.
„Wer glaubt, dass die Herausforderungen, die heute und in der Zukunft vor uns stehen, mit wirtschaftlich geschwächten Krankenhäusern bewältigt werden können, ist naiv. Wer glaubt, wir müssten nur die Strukturen verändern – vor allem wohl Kliniken schließen – und irgendwie die Digitalisierung vorantreiben, dann lösen sich alle Probleme von selbst, der ignoriert, dass dies alles viel Geld kostet“, so Dr. Düllings.
Wie könnten Lösungen aussehen?
Wesentliche Gründe für den aktuellen Finanz- und Personalmangel sind die historisch gewachsene dezentrale Krankenhausstruktur, die Unwilligkeit der Krankenkassen, die notwendige Personalausstattung zu finanzieren, sowie die Unwilligkeit der Länder, die nötigen Investitionen zur Strukturkonzentration bereitzustellen. Hier gilt es anzusetzen.
Diehistorisch gewachsene dezentrale Struktur der Krankenhausbranche muss auch aus Sicht des VKD aufgebrochen werden – jedoch mit Augenmaß, immer mit Blick auf die Versorgungssicherheit und unter Einbeziehung der Praktiker im Krankenhausmanagement. Ein solcher Prozess muss moderiert und natürlich auch finanziert werden. Davon kann derzeit keine Rede sein. Auf der Bundesebene werden Vorgaben gemacht, die zur Qualitätsverbesserung die Konzentration von Strukturen erfordern. Die Länder, die damit zwar offiziell konform gehen, verweigern dann aber die nötigen Fördermittel, die für die Gestaltung dieses Wandels notwendig sind – obwohl das Gesetz sie dazu verpflichtet.
Notwendig ist aus Sicht des VKD eine sorgsam geplante, moderierte und ausreichend finanzierte neue Struktur der Gesundheitsversorgung, deren Kerne die Krankenhäuser sind und in die alle Sektoren einbezogen werden. Diese Strukturen müssen regional und flexibel entsprechend den Versorgungsnotwendigkeiten gesteuert werden.
Hier kommen als dritte Ebene neben Bund und Ländern die Landkreise und Kommunen mit Bürgermeistern und Landräten vor Ort hinzu. Sie machen es den Krankenhäusern nicht immer leicht, zum Teil sogar unmöglich, sinnvolle Strukturveränderungen umzusetzen, selbst wenn genügend Geld da ist.
Die Forderung des VKD an Bundes-, Landes- und Ortsebene: Zieht endlich an einem Strang und stellt Euch proaktiv dem notwendigen Strukturwandel. Die Wiederaufnahme der Bund-Länder-Arbeitsgruppe wäre in diesem Zusammenhang aus Sicht des VKD eine gute Idee.
Die derzeit gültige Mehr-Ebenen-Rabattmechanik als ein System organisierter Unverantwortlichkeit dagegen gehört abgeschafft. Sie führt zu einem Strukturwandel über Pleiten und löst keines der aktuellen Probleme. Im Gegenteil: Sie werden verschärft.
Mit den Pflegestärkungsmaßnahmen wiederum hat der Bundesgesetzgeber erstmals für eine Dienstart eingegriffen. Ob das ein Modell für die Zukunft ist, lässt sich noch nicht einschätzen. Die Festlegung von Personaluntergrenzen, wie die Politik sie plant, wird vom VKD allerdings abgelehnt. Sie schränkt einen flexiblen Personaleinsatz entsprechend der Versorgungsnotwendigkeiten vor Ort durch das Management ein und sollte in der Mottenkiste der Misstrauenskultur versenkt werden. Der VKD plädiert hier, ebenso wie die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), für einen Ganzhausansatz mit Definition eines notwendigen Pflegebedarfs.
Einer der größten Zeitfresser in unseren Krankenhäusern ist die mit jeder neuen Regelung, jedem neuen Gesetz weiter anwachsende Bürokratie. Sie bindet Fachpersonal, frustriert Ärzte und Pflegende enorm und verschärft damit den Personalmangel immer weiter. Die überbordenden Dokumentationspflichten schaffen weder mehr Transparenz noch ermöglichen sie bessere Qualität. Den Geschäftsführungen ist klar, dass die Reduzierung von Komplexität und damit auch von Bürokratie eine enorme Aufgabe ist. Sie muss aber ebenfalls dringend angepackt werden.
Quelle: Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands e.V., Oranienburger Straße 17, 10178 Berlin, 02.05.2019