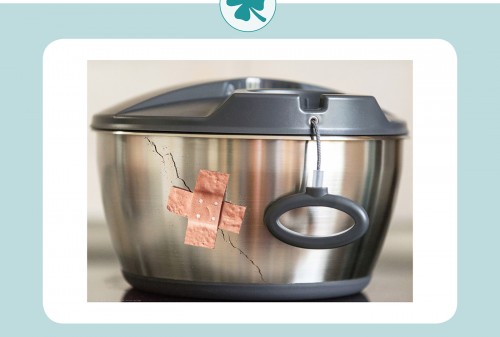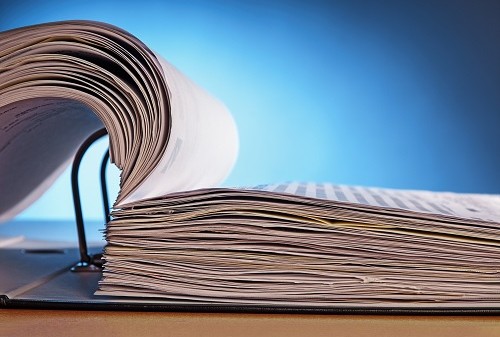Ein rechtlicher Anspruch auf eine unabhängige ärztliche Zweitmeinung besteht zukünftig auch bei geplanten arthroskopischen Eingriffen am Schultergelenk. Patientinnen und Patienten können sich bei einem qualifizierten Zweitmeiner zur Notwendigkeit des empfohlenen Eingriffs und zu alternativen Behandlungsmöglichkeiten beraten lassen. Die entsprechende Ergänzung der Zweitmeinungs-Richtlinie beschloss der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) am Freitag in Berlin. Bislang besteht ein Zweitmeinungsanspruch bei Operationen an den Gaumen- und/oder Rachenmandeln (Tonsillektomien, Tonsillotomien) sowie bei Gebärmutterentfernungen (Hysterektomien).
Unterstützung einer informierten Entscheidungsfindung bei planbaren arthroskopischen Eingriffen am Schultergelenk
Arthroskopien (Gelenkspiegelungen) an der Schulter dienen ganz überwiegend dazu, therapeutische Maßnahmen an den Gelenkstrukturen vorzunehmen. Erkrankungsbedingte Schmerzen und Einschränkungen der Beweglichkeit sollen reduziert oder beseitigt werden. Rein diagnostisch geplante Arthroskopien der Schulter sind die Ausnahme – in aller Regel werden die diagnostischen Möglichkeiten nur vorbereitend zu einer in derselben Sitzung erfolgenden therapeutischen Intervention genutzt.
Gegenstand des beschlossenen Zweitmeinungsverfahrens sind sämtliche arthroskopische Eingriffe am Schultergelenk, sofern sie planbar sind und es sich nicht um notfallmäßige Eingriffe handelt, die zeitnah erfolgen müssen. Das Zweitmeinungsangebot zielt darauf ab, eine informierte Entscheidungsfindung der Patientinnen und Patienten bei der Auswahl der operativen oder konservativen Behandlungsmöglichkeiten zu unterstützen und eine medizinisch nicht gebotene Schulterarthroskopie zu vermeiden.
Zweitmeinungsgebende Ärztinnen und Ärzte
Zweitmeinungsgebende Ärztinnen und Ärzte müssen die in der Zweitmeinungs-Richtlinie festgelegten Anforderungen an die besondere, eingriffsspezifische Qualifikation erfüllen. Zudem dürfen keine Interessenkonflikte vorliegen, die einer Unabhängigkeit der Zweitmeinung entgegenstehen.
Die Genehmigung, Zweitmeinungsleistungen zu planbaren Schulterarthroskopien abzurechnen, können Fachärztinnen und Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie für Physikalische und Rehabilitative Medizin bei ihrer Kassenärztlichen Vereinigung beantragen.
Inanspruchnahme des neuen Zweitmeinungsverfahrens
Der Beschluss wird nun dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur rechtlichen Prüfung vorgelegt. Er tritt nach Nichtbeanstandung durch das BMG und Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.
Hintergrund – Einholen einer ärztliche Zweitmeinung zu einer empfohlenen Operation
Gesetzlich krankenversicherte Patientinnen und Patienten haben gemäß § 27b SGB V einen Rechtsanspruch auf Einholung einer unabhängigen ärztlichen Zweitmeinung. Der G-BA ist gesetzlich beauftragt zu konkretisieren, für welche planbaren Eingriffe der Anspruch auf eine Zweitmeinung besteht. Zudem sind vom G-BA indikationsspezifische Anforderungen an die Abgabe der Zweitmeinung sowie an die Erbringer einer Zweitmeinung festzulegen. Die Erstfassung der Richtlinie zum Zweitmeinungsverfahren ist am 8. Dezember 2018 in Kraft getreten.
Informationen zum generellen Leistungsumfang des Zweitmeinungsverfahrens und der konkreten Inanspruchnahme stellt der G-BA für Patientinnen und Patienten in einem Merkblatt – neu auch in Leichter Sprache – zur Verfügung.
Spezifische Informationen zu den Eingriffen, zu denen ein Zweitmeinungsverfahren angeboten wird, bietet das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) an.
Ärztinnen und Ärzten, die aufgrund ihrer besonderen Qualifikation und Unabhängigkeit eine Zweitmeinung für den jeweiligen Eingriff abgeben dürfen, sind auf der Website des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zu finden.
Gemeinsamer Bundesausschuss
Pressekontakt:
Kristine Reis (Ltg.), Gudrun Köster, Annette Steger
Gutenbergstraße 13
10587 Berlin
presse@g-ba.de
Zur Pressemeldung der G-BA und weiteren Infos
Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA): Ärztliche Zweitmeinung zukünftig auch bei geplanter Schulterarthroskopie möglich. Passion Chirurgie. 2020 Januar, 10(01): Artikel 05_01.