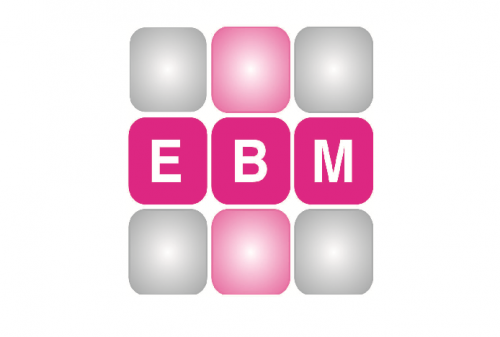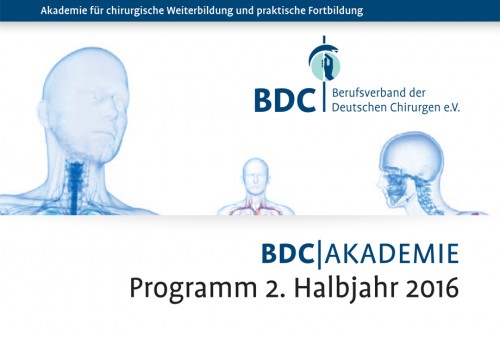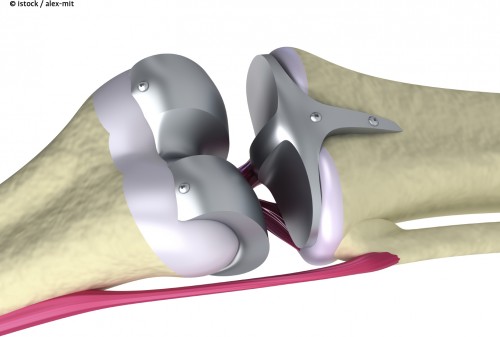Aus der Passion Chirurgie 07-08/ 2016
Prof. Dr. med. Matthias Anthuber wurde zum 3. Vizepräsidenten in den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) gewählt.
Prof. Dr. med. Henning Dralle, frisch emeritierter Ordinarius, wechselt laut einer Pressemitteilung an das Universitätsklinikum Essen.
Dr. med. Michael Euler übernimmt zum 1. Juli die Leitung der chirurgischen Abteilung im Marien-Hospital.
Prof. Dr. med. Martin Gasser ist seit April 2016 neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Klinikum Chemnitz – als Nachfolger von Prof. Dr. med. Joachim Boese-Landgraf.
Dr. med. Steffen Hahn ist seit Kurzem Oberarzt der Abteilung Chirurgie im Diakonie-Krankenhaus Bad Kreuznach.
Dr. med. Thomas Morkramer ist seit Juli 2016 neuer Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie des Sana Krankenhauses Radevormwald.
Dr. med. Martin Paetzold verstärkt ab Juli 2016 das Team des Medizinischen Versorgungszentrums Hann. Münden.
Prof. Dr. med. Tim Pohlemann ist seit dem 1. Juli 2016 neuer Präsident der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie.
Prof. Dr. med. Matthias Pross ist seit Anfang Mai 2016 neuer Ärztlicher Leiter der DRK Kliniken Berlin-Köpenick.
Ute Schaumann heißt die Nachfolgerin von Peter Oldorf auf dem Chefarztposten der Chirurgischen Klinik in Usingen.
Prof. Dr. med. Oliver Stöltzing ist seit Juni 2016 neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Elblandklinikum Riesa.
Dr. med. Nils Walther ist neuer Ärztlicher Direktor der Abteilung Chirurgie des Malteser Krankenhauses St. Carolus in Görlitz.
Aus Passion Chirurgie 09/2016
Lutz Alexander ist seit dem 1. August 2016 im Ortenauklinikum Wolfach als chirurgischer Oberarzt beschäftigt.
Dr. med. Barbara Bahr leitet ab September 2016 die Notaufnahme des Klinikums Landkreis Tuttlingen.
Dr. med. Meshal Elzien wechselte im Juli 2016 als leitender Oberarzt zum Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen.
Dr. Kia Homayounfar ist der neue Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Rot-Kreuz-Krankenhaus in Kassel.
PD Dr. med. Matthias Kapischke wird ab Oktober 2016 neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Gütersloh.
Dr. med. Marcus Krüger leitet seit Juli die Klinik für Thoraxchirurgie am Krankenhaus Martha-Maria in Halle (Saale).
Dr. med. Arnd Müller ist seit Juni 2016 neuer Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am KMG Klinikum Kyritz.
Dr. med. Thomas Plettner leitet seit Juli die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Diakoniekrankenhaus Halle.
Dr. med. Martin Pronadl übernahm zum 1. Juli 2016 die kommissarische Leitung der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- und Unfallchirurgie in Essen.
Dr. med. Jochen Schmand ist neuer Chefarzt der chirurgischen Abteilung der Klinik Füssen.
Dr. med. Henning Spieker ist neuer leitender Oberarzt der Viszeralchirurgie am Klinikum Döbeln.
Lars Stettinger ist neuer Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie in der Klinik Füssen.
| Der Berufsverband der Deutschen Chirurgen gratuliert seinen Mitgliedern zu den Auszeichnungen, Ernennungen und neuen Funktionen. |
| Bitte geben Sie uns Bescheid, wenn sich für Sie beruflich etwas ändert. Senden Sie uns einfach eine kurze Nachricht mit Ihrer neuen Funktion und wir veröffentlichen die Neuigkeiten an dieser Stelle, gerne auch mit Ihrem Foto. Bitte schreiben Sie an passion_chirurgie@bdc.de. |