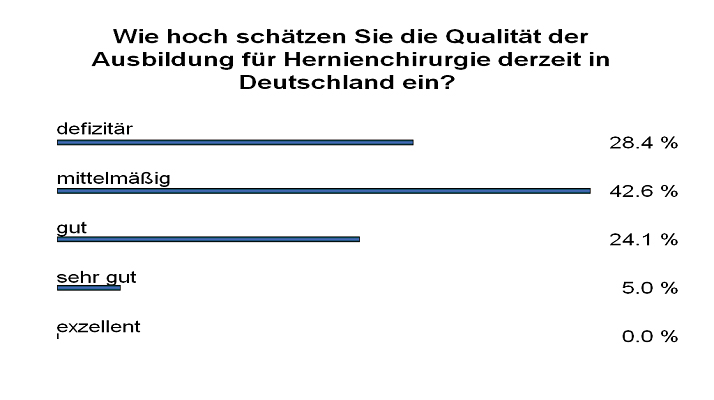Das DRG-System wurde 2003 flächendeckend in Deutschland eingeführt, um die Krankenhausfinanzierung transparenter und leistungsorientierter zu gestalten. Es basiert auf Fallpauschalen, die die Behandlungskosten eines Patienten standardisieren. Die EBM-Abrechnung (Einheitlicher Bewertungsmaßstab) hingegen ist das System, mit dem niedergelassene Ärzte, Psychotherapeuten und andere Leistungserbringer ambulante Leistungen zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abrechnen.
Die Einführung der gesetzlichen Krankenversicherung 1883 durch Otto von Bismarck schuf wesentliche Grundlagen für das deutsche Gesundheitssystem. Diese Versicherung ermöglichte Arbeitnehmern den Zugang zu ärztlicher Versorgung und Krankengeld:
- Die ambulante Versorgung wurde durch Vertragsärzte abgedeckt.
- Die stationäre Versorgung in Krankenhäusern blieb zunächst eine kommunale oder karitative Aufgabe.
Das Berliner Abkommen von 1913 legte fest, dass Vertragsärzte für die ambulante Versorgung zuständig sind, während Krankenhausärzte die stationäre Behandlung übernehmen. Diese Vereinbarung verstärkte die Trennung der Sektoren und führte zu einer strikten Abgrenzung der Tätigkeitsbereiche.
Mit der Einführung der Integrierten Versorgung (2000) und später durch das GKV-Versorgungsstrukturgesetz (2012) wurden erste Schritte unternommen, um die Sektorentrennung zu überwinden. Ziel war eine bessere Vernetzung zwischen ambulanten und stationären Leistungserbringern, die Vermeidung von Doppeluntersuchungen und eine effizientere Auslastung des Gesundheitssystems.
Operationen wurden bis vor wenigen Jahren überwiegend in stationären Einrichtungen durchgeführt, da die notwendige Infrastruktur, wie Operationssäle und Intensivstationen, nahezu ausschließlich in Krankenhäusern vorhanden war. Ambulante Eingriffe waren aufgrund von Sicherheitsbedenken und fehlender technischer Ausstattung in der ambulanten Versorgung nur eingeschränkt möglich.
Fortschritte in der Chirurgie, wie minimalinvasive Operationstechniken sowie moderne Narkoseverfahren, haben jedoch in den letzten Jahren zu einer deutlichen Verbesserung der ambulanten Versorgung geführt. Viele Eingriffe können heute ambulant durchgeführt werden, oft mit besseren Ergebnissen als in der stationären Versorgung.
Internationale Vergleiche und Herausforderungen in Deutschland
Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der Anzahl ambulanter Operationen hinter vielen Ländern zurück. Während in den USA, den Niederlanden und skandinavischen Ländern ein Großteil der Eingriffe ambulant erfolgt, werden in Deutschland weiterhin viele Operationen stationär durchgeführt.
Die Hauptgründe dafür sind ökonomischer Natur. Im ambulanten Sektor erfolgt die Abrechnung nach dem EBM, was zu einer erheblichen Ungleichheit in der Vergütung führt. Eine stationär durchgeführte Leistenhernienoperation wird im DRG-System nahezu zehnmal besser vergütet als im EBM-System. Dies führte dazu, dass bis vor Kurzem etwa 80 ٪ der Leistenhernien stationär versorgt wurden.
Einführung der Hybrid-DRG
Die Hybrid-DRG soll die Systeme des ambulanten und stationären Sektors vereinen. Erstmals wird eine Leistung, die sowohl von niedergelassenen Chirurgen als auch von Krankenhauschirurgen erbracht werden kann, in einem gemeinsamen Vergütungssystem abgebildet. Ziel ist es, die Anzahl der ambulanten Eingriffe deutlich zu erhöhen.
Die Einführung der Hybrid-DRG geht auf den Koalitionsvertrag der mittlerweile gescheiterten Ampelkoalition zurück. Sie wurde jedoch nicht durch die Selbstverwaltung des Gesundheitssystems entwickelt, sondern durch eine Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) am 19. Dezember 2023 veröffentlicht und trat am 01. Januar 2024 in Kraft. Eine Änderungsvereinbarung vom 21. Oktober 2024 erweitert die Regelungen ab 2025. Die Vertragsparteien der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen konnten sich innerhalb eines Jahres nicht auf eine Einigung über die geeigneten Eingriffe und deren Vergütung einigen. Der Ball wurde daher an das BMG zurückgespielt.
Herausforderungen bei der Umsetzung
Zwischen der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten der Verordnung lagen nur 12 Tage, was die Akteure und Leistungserbringer vor große Herausforderungen stellte. Insbesondere die Abrechnung funktionierte anfangs nicht reibungslos. Sie erforderte entweder zertifizierte Grouper, die Unterstützung einer Managementgesellschaft oder der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Unterschiedliche Interpretationen der Verordnung führten zu vielfältigen Abrechnungstheorien.
Tab. 1: Hernienrelevante Hybrid-DRG 2024
|
Hybrid-DRG |
Text |
Entgelt |
Pseudoziffer (KV) |
|
G 24 M |
Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, Alter > 13 Jahre oder ohne äußerst schwere oder schwere CC |
1.653,41 € |
83001 |
|
G 24 N |
Eingriffe bei Hernien ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand, mit beidseitigem oder komplexem Eingriff oder Alter < 14 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC |
1.965,05 € |
83002 |
|
G 09 N |
Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkel-hernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien oder Operation einer Hydrocele testis oder andere kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm |
2.021,82 € |
83001 |
Erst zum Ende des ersten Quartals 2024 konnten niedergelassene Kollegen die Hybrid-DRG über die KVen abrechnen. Bis dahin mussten Leistungserbringer für Partner, OP-Zentren, Angestellte und Sachkosten in Vorleistung treten. Eine Auszahlung erfolgte teilweise als Abschlag durch die KV oder im Rahmen der regulären Quartalsabrechnung – also mit einer Verzögerung von bis zu sechs Monaten. Dabei fielen Bearbeitungsgebühren von bis zu 3 ٪ an.
Hybrid-DRG in der Hernienchirurgie
In der Hernienchirurgie gibt es derzeit drei Hybrid-DRGs (siehe Tabelle). Diese umfassen:
- Alle primären Leistenhernien, unabhängig von der Methode.
- Nabel- und epigastrische Hernien, allerdings nur bei Nahtverfahren.
- Beidseitige Leistenhernien, die in eine höhere Hybrid-DRG verzweigen.
Für das Jahr 2025 sind Erweiterungen geplant:
- Netzverfahren bei primären Ventralhernien werden ebenfalls als Hybrid-DRG abgebildet.
- Minimalinvasive Operationen von Narbenhernien bis 10 cm werden ebenfalls erfasst.
- Offene Verfahren für Narbenhernien bleiben jedoch im aDRG-System.
Kritische Betrachtung der Hybrid-DRG in der Hernienchirurgie
Eine kritische Analyse der Hybrid-DRG im Bereich der Hernienchirurgie offenbart derzeit nur wenige positive Aspekte. Selbst diese erscheinen bei näherer Betrachtung ambivalent.
Ein positiver Punkt ist die Einführung einer sektorenübergreifenden Vergütung. Erstmals haben niedergelassene Chirurgen die Möglichkeit, ihre Leistungen im DRG-System abzubilden. Darüber hinaus können sie, sofern die entsprechende Infrastruktur vorhanden ist, Patienten nach einem Eingriff für eine Nacht stationär überwachen – eine Möglichkeit, die bisher ausschließlich Krankenhäusern vorbehalten war. Weitere klare Vorteile der Hybrid-DRG lassen sich schwer ausmachen. Die überhastete Einführung, unklare Abrechnungswege und die unscharfe Definition, welche Leistungen genau unter die Hybrid-DRG fallen und mit dieser abgegolten sind, erschweren die Umsetzung erheblich.
Herausforderungen der Hybrid-DRG
Trotz der sektorenübergreifenden Vergütung bestehen weiterhin strukturelle Unterschiede, die die Ergebnisse für verschiedene Akteure beeinflussen.
I. Vergütung und Kosten
1. Kalkulation
Die Berechnung der Hybrid-DRG basiert auf einer Mischung aus stationären und ambulanten Daten. Die Datengrundlage, die jeweils zwei Jahre vor der Kalkulation erhoben wird, stammt vom InEK (Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus) für die DRG-Daten und vom InBA (Institut des Bewertungsausschusses) für die EBM-Daten.
Allerdings fließen wichtige Faktoren wie Preissteigerungen, Lohnentwicklungen und Inflation nicht in die Berechnungen ein. Die ambulanten Daten werden anhand von Stichproben aus bestimmten Jahrgängen erhoben und anschließend hochgerechnet. Die Sachkosten basieren ausschließlich auf Daten des InEK und berücksichtigen daher nicht die teils erheblichen Preisunterschiede bei Materialien, wie z. B. Netzen im ambulanten Bereich.
Die Validität der zugrunde liegenden Daten, insbesondere aus dem ambulanten Sektor, ist daher stark anzuzweifeln.
Berechnungsformel Hybrid-DRG:
Hybrid-DRG = AG * Fallwertambulant + (1 − AG) * Kostenstationär
Ambulantisierungsgrad α = Anzahl ambulanter Fälle / Gesamtfallzahl stationärer und ambulanter Bereich
2. Sachkosten
Aktuell müssen die Kosten für Herniennetze durch die Hybrid-DRG gedeckt werden. Dabei bestehen nach wie vor erhebliche Preisunterschiede zwischen dem Krankenhaussektor und dem ambulanten Sektor. Im ambulanten Bereich können die Einkaufspreise für Netze mehr als doppelt so hoch sein wie die Preise, die Krankenhäuser zahlen. Da bei der Ermittlung der Sachkostenanteile in der Hybrid-DRG ausschließlich stationäre Daten herangezogen wurden, entsteht im ambulanten Sektor ein erheblicher Kostendruck. Dies führt oft dazu, dass netzfreie Verfahren bevorzugt werden – entgegen den aktuellen Leitlinien.
Auch die endoskopischen Verfahren sind davon betroffen, da sie durch die Kosten für Geräte und Trokare teurer sind als offene Verfahren. Das kostengünstigste Vorgehen bleibt ein netzfreies Verfahren in Lokalanästhesie. Materialien wie Nahtmaterial, Pflaster, Desinfektionslösungen und Kompressen gelten derzeit in den meisten Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) noch als Sprechstundenbedarf. Jedoch gibt es föderale Unterschiede zwischen den einzelnen KVen, sodass die Regelungen von Bundesland zu Bundesland variieren können. Dieser Aspekt stellt einen Vorteil für ambulant tätige Chirurgen dar.
Ab dem kommenden Jahr (2025) sollen auch primäre Ventralhernien mit Netz als Hybrid-DRG abgerechnet werden. Sollte die Vergütung jedoch nicht angepasst werden, könnte dies zu einer Renaissance netzfreier Verfahren und sogar zu einer Wiederbelebung längst veralteter Operationsmethoden wie der Fasziendoppelung nach Mayo führen.
3. Nebenkosten
Die Nebenkosten sind ein weiterer kritischer Aspekt der Hybrid-DRG. Während Krankenhauspathologen ihre Kosten im Rahmen der Hybrid-DRG decken müssen, kann ein niedergelassener Chirurg das Operationspräparat auf einem Laborschein zur Untersuchung einschicken, ohne selbst mit den Kosten belastet zu werden. Zudem werden andere Nebenkosten wie Strom, Heizung und Wasser in der Kalkulation der Hybrid-DRG nicht berücksichtigt. Dies stellt eine Herausforderung dar, insbesondere für Einrichtungen mit höheren Betriebskosten.
4. Personalkosten
Die Personalkosten müssen in beiden Sektoren aus der Hybrid-DRG finanziert werden. Im ambulanten Bereich ist es jedoch seit Jahren üblich, mit deutlich weniger Personal auszukommen als in Krankenhäusern. Niedergelassene Chirurgen arbeiten häufig in einem minimalistischen Setting, das oft lediglich aus dem Chirurgen selbst und einer Operationsschwester besteht. Dieser Unterschied in den Personalanforderungen sorgt für eine strukturelle Ungleichheit zwischen den beiden Sektoren.
II. Verteilung der Vergütung
1. Krankenhaus
Die Verteilung der Hybrid-DRG im Krankenhaus ist klar geregelt: Das Krankenhaus muss aus den Gesamterlösen alle beteiligten Mitarbeiter und die Sachkosten decken. Betrachtet man die Kosten auf den einzelnen Fall heruntergebrochen, wird schnell deutlich, dass es kaum kostendeckend möglich ist, Hybrid-DRGs in der bestehenden Infrastruktur des Krankenhauses abzubilden. Oft fehlen die räumlichen und logistischen Voraussetzungen für das ambulante Operieren. Ambulante OP-Einheiten, die den Patienten beispielsweise ermöglichen, Wertsachen und persönliche Kleidung sicher zu verwahren, sich umzuziehen und postoperativ schnell wieder das Krankenhaus zu verlassen, sind entweder nicht vorhanden oder werden auf normalen Stationen durchgeführt – neben dem stationären Betrieb. Die erforderliche Infrastruktur für eine effiziente und sichere Durchführung von Hybrid-DRG-Operationen fehlt somit häufig.
2. Niedergelassener Chirurg oder Praxisklinik
Der selbstständige Leistungserbringer rechnet hingegen pro Fall mit den beteiligten Akteuren ab. Dabei hängt die genaue Verteilung von der Verhandlungskompetenz des Chirurgen und den beteiligten Akteuren ab. Aus den Erlösen der Hybrid-DRG müssen der Anästhesist und alle anderen OP-Kosten bezahlt werden. In diesem Zusammenhang ist entscheidend, wem der OP gehört und wer den Aufwachraum versorgt. Dabei spielt es eine Rolle, ob die Anästhesisten Angestellte des OP-Zentrums sind oder als selbstständige Dienstleister arbeiten. Aufgrund des Kostendrucks wird der Leistungserbringer in der Regel Verfahren wählen, die vor allem kostengünstig sind. Dies kann dazu führen, dass endoskopische Verfahren vermieden werden, zugunsten von netzfreien und möglichst preiswerten Narkoseverfahren.
Welche Fälle sind geeignet, als Hybrid-DRG abgerechnet zu werden, welche nicht?
Die Vorstände der Herniengesellschaften aus Österreich (ÖHG), der Schweiz (SAHC) und Deutschland (DHG / CAH der DGAV) haben im Februar 2023 in einer wissenschaftlich begründeten Stellungnahme auf die Risiken eines rein ambulanten oder kurzstationären Vorgehens bei der Leistenhernienchirurgie hingewiesen. Die Hybrid-DRG für die Hernienchirurgie umfasst alle primären Leistenhernien und primären Ventralhernien, unabhängig von deren Größe oder dem Vorliegen von Komorbiditäten, in einer einzigen Kategorie. Die Entscheidung, ob ein Fall in eine klassische DRG eingegliedert werden sollte, hängt von Kontextfaktoren ab, die eine Hernienoperation für bestimmte Patienten aus medizinischen Gründen unangebracht machen können. So wird ein Patient, der schwerstpflegebedürftig ist, in der Regel nicht elektiv an einer Leistenhernie operiert.
Die Interpretation dieser Kriterien wird von den Krankenhäusern jedoch unterschiedlich gehandhabt. Manchmal wird aus Angst vor möglichen Reklamationen des Medizinischen Diensts und in vorauseilendem Gehorsam jeder Patient mit einer Leistenhernie möglichst ambulant operiert. In anderen Fällen wird jeder Patient, der eine stationäre Überwachung benötigt, mindestens für zwei Tage aufgenommen, um in die klassische DRG einzutreten. Die Ermittlung der geeigneten Diagnosen für die Hybrid-DRG erfolgte auf Grundlage von Gutachten. Diese Gutachten berücksichtigen allgemeine Kontextfaktoren und Schweregrade bei einer Diagnose, allerdings wird oft der individuelle Schweregrad des Falles, wie etwa die Größe der Hernie, nicht ausreichend in Betracht gezogen. Es entsteht der Eindruck, dass das wichtigste Kriterium für die Hybrid-DRG eine hohe Fallzahl bei kurzer Liegedauer ist. Eine genaue Analyse, welche Fälle länger als eine Nacht stationär verbleiben, wurde bisher entweder nicht oder nur unzureichend durchgeführt.
Was erwartet uns im Jahr 2025?
In einer Änderungsvereinbarung vom 18.12.2025 haben sich der GKV-Spitzenverband, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und die Kassenärztliche Bundesvereinigung auf einen angepassten Leistungskatalog für das Jahr 2025 geeinigt. Die Kalkulation der neuen Hybrid-DRG wird nach dem gleichen Prinzip wie in der Startphase erfolgen, jedoch soll künftig ein stärkerer Fokus auf die Sachkosten gelegt werden. Ziel ist es, etwa 200.000 Eingriffe, die derzeit vollstationär durchgeführt werden, zu „ambulantisieren“. Diese Änderungen betreffen auch Eingriffe in der Hernienchirurgie, die bisher nicht als Hybrid-DRG abgerechnet wurden. Dazu zählen:
- Primäre Ventralhernien (epigastrisch und umbilikal) mit Netz, unabhängig von der Art des Einbringens oder der Schicht des Netzes in der Bauchwand.
- Narbenhernien* bis 10 cm, wenn sie minimalinvasiv behandelt werden, unabhängig von der Schicht in der Bauchwand (z. B. eMILOS, eTEP, Lap. IPOM etc.).
* Die genannten Narbenhernien bis 10 cm in minimalinvasiver Technik sind in der Hybrid-DRG Vergütungsvereinbarung in der Fassung vom 18.12.2024 enthalten und wurden bisher nicht überarbeitet. Wenn jedoch die in der Anlage aufgeführten entsprechenden OPS-Kodes im von der INEK programmierten Grouper eingegeben werden, verzweigen diese in eine aDRG G08B und schließen damit die Hybrid-DRG G24M aus. Das bedeutet, dass der GKV-Spitzenverband, die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die DKV eine fehlerhafte Vergütungsvereinbarung veröffentlicht haben, die bis heute nicht korrigiert wurde.
Lediglich die Nahtverfahren bei Narbenhernien münden in eine Hybrid-DRG. Dies zeigt den mathematischen Charakter der Auswahl und wer letztendlich entscheidet, was eine Hybrid-DRG ist und was nicht. Insgesamt wurde die Vergütung der Hybrid-DRG für 2025 in der Hernienchirurgie um ca. 1,35 % gesteigert. Auch dies verdeutlicht erneut den rein mathematischen Charakter der Auswahl und die Entscheidungsprozesse, die bestimmen, was als Hybrid-DRG gilt und was nicht. Medizinisch-technische Faktoren spielen praktisch keine Rolle.
Zusammenfassung
Die Einführung der Hybrid-DRG als sektorenübergreifendes Modell für den Klinik- und den ambulanten Sektor ist grundsätzlich zu begrüßen. Die seit dem 1. Januar 2024 existierenden Hybrid-DRGs für die Hernienchirurgie sind jedoch inhaltlich und fachlich unzureichend und daher problematisch. Zu den zentralen Kritikpunkten zählen:
- Die gesamte Kalkulation der Hybrid-DRG und damit die Vergütung, die auf fehlerhaften und unzulänglichen Daten basiert.
- Die unausgewogene Vergütung der Sachkosten, die ausschließlich auf Krankenhausdaten beruht und die einen Druck in Richtung historischer Operationsverfahren ausübt.
- Das Fehlen von Schweregraden und Hernien-spezifischen Komplexitätskriterien.
- Eine sinnlose Liste von Kontextfaktoren, die die Anwendung der Hybrid-DRG ausschließen sollen.
- Die Auswahl von modernen Operationsverfahren für 2025, die in der Durchführung komplexer sind als klassische Verfahren, aber Vorteile für Patienten in Bezug auf Liegedauer und Rekonvaleszenz bieten.
Stechemesser B: Hernien- und Hybrid-DRG: Fluch oder Segen? Passion Chirurgie. 2025 Januar/Februar; 15(01/02): Artikel 03_03.