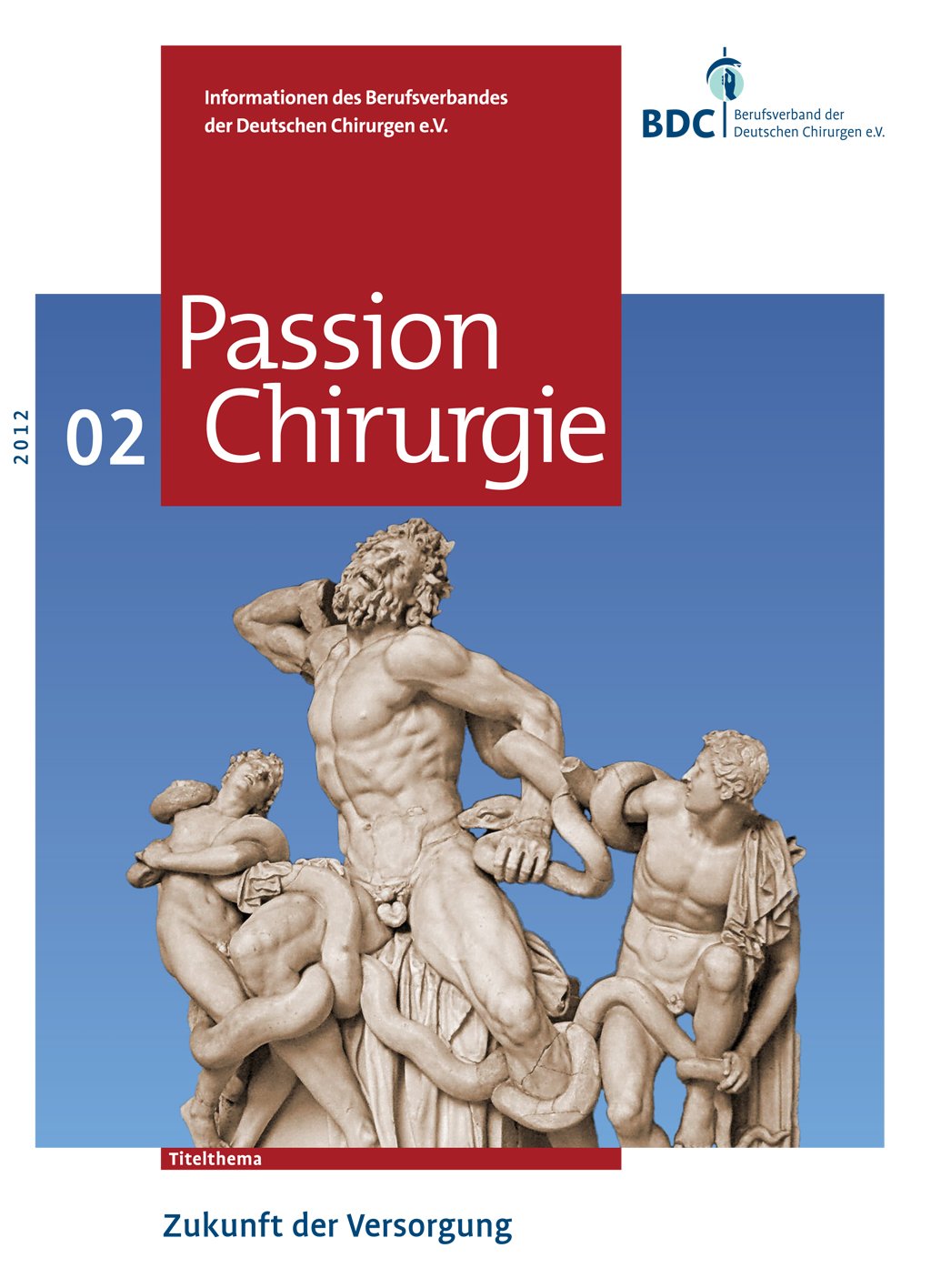01.07.2010 BDC|Spektrum
50 Jahre Berufsverband der Deutschen Chirurgen Rede am 12.06.10

Verehrte Festversammlung,
der Berufsverband der Deutschen Chirurgen hat sich in den fünfzig Jahren seit der Gründung 1960 mit derzeit fast 16.000 Mitgliedern nicht zum größten, das wäre viel-leicht falsch zu verstehen, doch zum mitgliederstärksten Chirurgenverband in der Europäischen Union entwickelt. Er hat sich über unsere nationalen Grenzen hinaus durch das Eintreten für die beruflichen Belange der Chirurgen und Chirurginnen Anerkennung erworben. Diese Entwicklung haben wir versucht, in unserem Jubiläumsheft im April DER CHIRURG BDC darzustellen.
Das Fachgebiet Chirurgie war eines der letzten Gebiete, das neben der wissen-schaftlichen Fachgesellschaft einen Berufsverband nach dem 2. Weltkrieg gründete. Dies, nach erheblichen Geburtswehen, die primär auf den nicht zu vereinbarenden Charakteren der beiden Persönlichkeiten zurückzuführen war, die die beiden Lager vertraten. Hier die wissenschaftliche Sicht: „So etwas braucht man nicht“ und dort die berufspolitische Sicht: „Wir müssen uns für den Erhalt des Chirurgen als Beruf selbst einsetzen“. Sicher spielten, obwohl 15 Jahre nach dem 2. Weltkrieg auch noch Befindlichkeiten unterschiedlicher Biographien aus dem 3. Reich eine Rolle.
In seinem Buch „Der Beruf des Chirurgen“ schreibt 1970 der damalige Präsident des BDC, Prof. Müller-Osten: „Befangen in der Wertvorstellung des 19. Jahrhunderts und beeindruckt vom selbst errichteten Status verzichten viele Chirurgen – und mit Ihnen auch Angehörige anderer Arztgruppen – darauf, sich Gedanken über die Zukunft ihres Berufes zu machen. Einige glauben noch in einer Welt tradierter Ordnung leben zu können und verkennen, dass ihre Inselposition längst unterspült ist.“
Es waren die besonderen Umstände nach dem 2. Weltkrieg, die für den Berufsstand der Ärzte im Allgemeinen und der einzelnen Fachgebiete im Speziellen notwendig machten, für die beruflichen Belange selbst einzutreten.
In den Krankenhäusern arbeiteten die Ärzte auf Halb- manchmal auch auf Drittel-stellen, trotz einer 60 bis 80 Stundenwoche. An den Universitäten war es üblich für Jahre als Beamter auf Widerruf bei jeweils 6-monatiger Verlängerung zu arbeiten.
Der Grund lag also einmal in den schlechten wirtschaftlichen Bedingungen der Ärzte – bis Mitte der 60er Jahre waren die Arbeitsbedingungen mehr als schlecht. Aber in der Demokratie, besonders in einem sozialen Rechtstaat, lernten wir schnell, sich für seine beruflichen Belange selbst zu organisieren und zu engagieren. Dies jedoch war ein politisches Geschäft, zumindest in dieser Zeit noch schwer vereinbar mit den hehren Zielen der Wissenschaft.
Zusätzlich begann Ende der 50er zunehmend die Spezialisierung in den großen Fächern der Medizin. Dies warf erhebliche Abgrenzungsprobleme auf. Letztlich – und dies ist in allen Gesellschaften so – muss jeder Berufsstand seine Position in der Gesellschaft selbst verteidigen.
Dennoch müssen wir Erkennen, dass in der Geschichte der Heilkunde die Chirurgie stets um die Anerkennung und Stellung ihres Berufes kämpfen musste.
Wir erinnern uns alle an den Satz aus dem hypokratischen Schrifttum: „Was Arzneien nicht heilen können, heilt das Messer“. Hieraus erklärt sich bereits zu den Anfängen der Heilkunde, die noch primär die Ursachen für Krankheiten im Religiösen suchte, in der direkten Handlung der Götter sah – die stete Herausforderung für die Chirurgen sich gleichzeitig vom Internisten auf der einen Seite, auf der anderen von den sog. Wundärzten (Feldschären, Badern, Stein-schneidern usw.) wie immer sie genannt wurden, abzugrenzen.
Ich zitiere hier aus einem Vortrag von Bergdolt.
Wir wissen der neueren Forschung nach, dass bereits im 13./14. Jahrhundert die wirklichen, die echten Chirurgen eine zusätzliche – zwar noch nicht naturwissen-schaftliche, so doch aber eine akademisch, universitäre Ausbildung genossen haben und gesellschaftlich über den Internisten standen.
So berichtet im 13. Jahrhundert Henri de Mondeville, Universitätsprofessor in Mont-pellier: „Der Chirurg sei nach der Volksmeinung seit undenklichen Zeiten ein Dieb, Mörder oder Schwindler. Man verdanke diesem Ruf Hochstaplern und selbst ernannten Vertretern der ursprünglichen hohen und erlesenen Kunst, welche die Wissenschaft nicht durch die für den Eingang bestimmten Pforte betreten hätten. Solche Betrüger operierten rein mechanisch, wie es im Schneiderhandwerk üblich ist. Dagegen ist der gute Chirurg in der Lage, seine Handlungen theoretisch zu begründen. Er operiert mit Verstand, Überlegung und Weitsicht und übertrifft den normalen Physikus durch seine praktische manuelle Erfahrung. Ist Euch denn nicht klar, dass er die Gesundheit erhält, die Krankheit bekämpft, erkrankte Glieder repariert und somit Leben rettet?“ lautet seine rhetorische Frage.
Ein Praktiker brauche ausgiebig theoretisches Wissen, um seine Kunst zu vervoll-kommnen. Hart kritisierte Mondeville allerdings die Kollegenschaar. Er schlug, um das Imagegerangel zwischen den übrigen Ärzten und den Chirurgen zu beenden, eine Aufteilung der Kompetenzen vor, wie man sich zwischen den Besitzungen von Brüdern und Verwandten Grenzen ziehen muss, um Streit zu vermeiden. Zitat Ende
Klingt doch sehr zeitgemäß, wenn man sich der Absprachen zwischen den heutigen Fachgesellschaften und Berufsverbänden in den letzten Jahrzehnten erinnert. Ärztliche Berufspolitik, vertraglich geregelt vor 800 Jahren.
Die Abgrenzung der Chirurgen von den nur Handwerkern erfolgte durch die Ver-pflichtung zur zusätzlichen universitären Ausbildung, die mit der Approbation und erstmals im Jahr 1508 an der medizinische Fakultät Wittenberg mit Ablegung des Hypokratischen Eides abgeschlossen wurde.
Die Chirurgen zu der damaligen Zeit waren jedoch in der Regel – wir würden heute sagen – auf dem zweiten Bildungsweg in ihren Beruf gekommen: Erst das Handwerk, dann das Studium.
Der Berufsstand der Chirurgen wurde – es gab ja nicht viele – meist von einzelnen Persönlichkeiten vertreten. Wobei ich sicher bin, dass die Auseinandersetzung mit ihren Fürsten in der damaligen Zeit auch nicht einfacher war, als mit unseren heuti-gen von uns gewählten „Fürsten“.
Der Berufsstand der Ärzte, insbesondere der Chirurgen, musste sich schon immer rechtfertigen und für die Selbstständigkeit kämpfen. Dies wurde nach der Trennung der bestallten Ärzte und Chirurgen von den übrigen Heilkundlern nicht einfacher.
Bis ins 16./17. Jahrhundert waren die Chirurgen ein kleines Häufchen, die ihre beruflichen Anrechte selbst durch ihr Können und ihre Persönlichkeit erkämpfen und verteidigen mussten.
Im 18. Jahrhundert etablierten sich erstmals größere Vereinigungen, die die Wissenschaft und den Berufsstand der Chirurgen vertraten:
Das College de Saint-Come, die Akademie Royale de Chirurgie, The Royal College of Surgeon, und vorher noch unter Friedrich dem Großen das medizinische College und 1719 bereits die Deutsche Wissenschaftliche Chirurgie.
Bis in die Zeit nach dem 1. Weltkrieg erfolgt die berufspolitische Vertretung weiterhin fast ausschließlich durch einzelne Persönlichkeiten. Als bekanntestes Beispiel wird immer Virchow genannt, der Arzt zwischen Charitée und Reichstag. Aber auch Hufeland und Billroth haben sich hier ausgezeichnet.
Drei kurze Zitate der genannten Herren, zunächst Hufeland [1]:
Zur Beantwortung der Frage, ob Ärzte als freie Künstler oder Staatsbeamte zu be-trachten sind, sagt er: „die Ärzte wünschten sich als freie Künstler betrachtet sobald sie zur Rechenschaft gezogen, als Staatsbeamte jedoch dagegen, wenn sie nicht begünstigt werden.“
Virchow über den unhaltbaren Zustand der After-Mediziner, das heißt der nicht-approbierten Heilkundler, während seiner Zeit in Berlin [2]: „Die After-Medizin auszurotten ist in der Tat für die Polizei ebenso unmöglich, wie für den Arzt jeden Kranken zu heilen oder auch nur zu bessern.“
Und drittens Billtoth 1872 in einem Brief an Brahms: „Ich habe übrigens seit vielen Jahren das Paradoxon aufgestellt, dass die steigende Vervollkommnung der ärztli-chen Kunst wohl dem Individuum zugute kommt, die menschliche Gesellschaft aber ruinieren wird.“
Diese drei Beispiele zeigen die drei klassischen berufsständischen Herausforderungen, die, wie man sieht, fast zeitlos sind:
- die Anerkennung des Berufsstandes,
- die Abgrenzung zu anderen Heilkundlern und
- die ökonomischen Auswirkungen
Nach dem 2. Weltkrieg stellte der Wandel der Gesellschaft, die soziale Gesetzge-bung und der rasante medizinische Fortschritt, zusätzliche Herausforderungen an den Berufsstand des Chirurgen.
- Im Wandel der Gesellschaft zeigt sich, das es primär nicht mehr um Behand-lung von Krankheiten geht, sondern um ein möglichst langes Leben in Ge-sundheit mit möglichst hoher Qualität. Bereits 1976 beschrieb die World Health Organisation „Gesundheit ist der Zustand vollkommenen, körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefindens“, nicht etwa alleine das Fehlen von Krankheiten oder Gebrechen. Ein nicht erfüllbar, hoher An-spruch. Leider wird dieser auch heute noch von der Politik so propagiert.
- Der medizinische Fortschritt entwickelt sich mehr und mehr zu einer Falle für die Eigenständigkeit der Chirurgie. Im Zeitalter der Molekularbiologie hat – man kann es am Streit um die gerechte Berechnung und Vergleichbarkeit des Impact Factors ablesen, die Chirurgie zumindest schlechte Karten, solange wie Gesellschaft und Politik ihre ganze Hoffnung in diese neue mögliche Behandlungsmethode legt.
Auch wenn jeder darüber übereinstimmen wird, dass auch in der Versorgung von Kranken die Gesetze der schwäbischen Hausfrau gelten, so hat dennoch die Öko-nomie eine Beherrschung über die Krankenversorgung mit vielen, vielen Anreizen angenommen, den ich mit dem Zitat aus dem New England Journal of Medecine hier skizzieren will:
„Die Rolle der Ärzte hat sich radikal verändert, sie werden heute von Managern un-terwiesen und sind nicht länger Anwälte der Patienten. Das Ziel der Medizin ist eine gesunde Bilanz statt einer gesunden Population. Der Schwerpunkt liegt auf Effizienz, Profitmaximierung, Kundenzufriedenheit, Zahlungsfähigkeit, Unternehmertum und Wettbewerb. Die Idiologie der Medizin wird ersetzt durch die Idiologie des Marktes. In dem Maße, in dem eine Medizin zum Kapitalunternehmen wird, wird die medizinische Ethik durch die Geschäftsethik verdrängt.“
Paul Unschuld beschreibt dies in seinem kleinen Büchlein ‚Ware Gesundheit, das Ende der klassischen Medizin’ sehr treffend, in dem er sagt: “Tatsächlich kann man die Deprofessionalisierung, also die schwindende fachliche Unabhängigkeit der Ärzte, an drei zentralen Dimensionen beruflicher Tätigkeit verständlich machen. „Zu einem vollkommenen Standesberuf gehören drei Merkmale:
- Die Mitglieder der Standesgruppe schaffen ihr Wissen selbst.
- Sie entscheiden selbstständig über die Anwendung des Wissens.
- Sie können auch selbstständig darüber verfügen, welche Entlohnung sie für ihre fachliche Tätigkeit erhalten.
Die Deprofessionalisierung ist der Verlust der Selbstständigkeit und führt somit zu einer zunehmenden Abhängigkeit in allen Bereichen.
Es ist uns seit langem bekannt, das die medizinische, ganz besonders aber auch die chirurgische Tätigkeit, mehr und mehr zu einer reinen Dienstleistung wird und vielleicht liegt in diesem, der Zuspruch zu dem in Deutschland neuen, bisher nicht üblichen Arzttyp dem Honorararzt.
Zu den Bemühungen eines Verbandes um einen Berufsstand gehört sich um den Nachwuchs zu kümmern, der Basis jeden Berufes, durch Vorgabe der qualitativen Voraussetzungen. Daher gehört Aus-, Weiter- und Fortbildung zu der ersten Aufgabe eines Berufsverbandes.
Die aktuelle Herausforderung in der heutigen Zeit ist der Nachwuchsmangel. 1961/62 beantwortet Müller-Osten die Frage: Was ist zu tun, um den Nachwuchs zu steuern?
Man muss besser dotieren, Verträge langfristig abschließen, angemessene Arbeits-zeiten anbieten und die Assistenten besser im selbstständigen Operieren schulen.
Dies lesend scheint, scheint sich nicht viel in den 50 Jahren geändert zu haben. Wie bemühen uns noch immer um die Verbesserung der selben Dinge, mit dem gravierenden Unterschied, dass der Nachwuchsmangel trotz aller Bemühungen zur Zeit besonders in den operativen Fächern noch immer zunimmt.
Lassen Sie mich zum Schluss noch eine Frage beantworten. Was ist der Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Gesellschaft und einem Berufsverband? Meine Antwort war stets: Die wissenschaftliche Gesellschaft ist für die Chirurgie; der Berufsverband für die Chirurginnen und Chirurgen zuständig.
Ich weiß, dass sich viele an dieser verkürzten Form oft gestört haben, doch die Defi-nition stammt von keinem geringeren als Rudolf Nissen. Er schrieb 1970 im Geleit-wort für das Buch „Der Beruf des Chirurgen“ von Müller-Osten: „Hier in diesem Buch sind die Grundlagen der Berufsausbildung des Chirurgen untersucht und die Voraussetzung für die Analyse des Berufes geschaffen worden. Dadurch tritt neben die Wissenschaft von der Chirurgie erstmals eine Wissenschaft vom Beruf des Chirurgen.“
Darin steckt auch die eindeutige Aufforderung, das jeder seine Wissenschaft zur hohen Blüte bringe, aber beide gemeinsam die Voraussetzung dazu schaffen, die Attraktivität eines der schönsten Berufe durch quantitativ ausreichend, qualitativ hervorragend und mit hoher Empathie ausgestatteten Nachwuchs zu erhalten.
Denn von einem sind wir doch alle überzeugt: Der Beruf der Chirurginnen und Chi-rurgen ist einer der schönsten.
Ich bin aber auch überzeugt, dass wir unser Ziel nun gemeinsam erreichen werden.
Vielen Dank
Literatur:
[1] C. W. Hufeland (Hsg.): Bibliothek der praktischen Heilkunde, 1815
[2] R. Virchow, Die medizinische Reform ‚Über medizinische Pfuscherei und Polizei’, 1848
Autor des Artikels
Prof. Dr. med. Michael-J. Polonius
Ehem. BDC-PräsidentBerlinWeitere Artikel zum Thema
01.09.2007 BDC|Spektrum
Referat Niedergelassene Chirurgen neu konstituiert
Am 7. Juli 2007 haben sich in Berlin erstmalig die
01.07.2007 BDC|Spektrum
Das chirurgische Qualitätssiegel (CQS)
Ziel medizinischer Fortbildung ist der Erhalt und die Weiterentwicklung ärztlicher Kompetenz bei Fachärzten, da sie die Grundlage bietet für eine optimale und qualitativ hochwertige Patientenversorgung. Fortbildung ist vor dem Hintergrund einer zunehmenden Spezialisierung und der steigenden Qualitätsansprüche von Patienten und Kostenträgern in Verbindung mit medizinisch-technischen Fortschritten unerlässlich.
01.06.2007 BDC|Spektrum
Beitragsanpassung für nicht berufstätige Mitglieder des BDC
Wie im Bericht des Schatzmeisters anlässlich der Mitgliederversammlung des BDC in München am 2. Mai 2007 deutlich wurde, zeichnet sich in der Mitgliederstruktur des Berufsverbandes, entsprechend der allgemeinen Demographie, ein zunehmender Anteil von beruflich nicht aktiven Mitgliedern ab. Dieser Anteil betrug im vergangenen Jahr ca. 1.800 Mitglieder und wird zukünftig ansteigen.
01.04.2007 BDC|Spektrum
Strukturierte Chirurgische Weiterbildung und Einsatz von Logbüchern
Qualität der chirurgischen Weiterbildung Der Beruf des Chirurgen hat in
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.