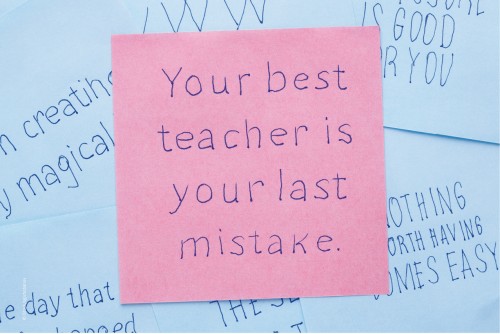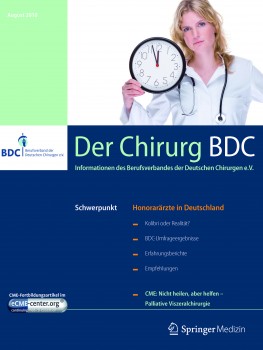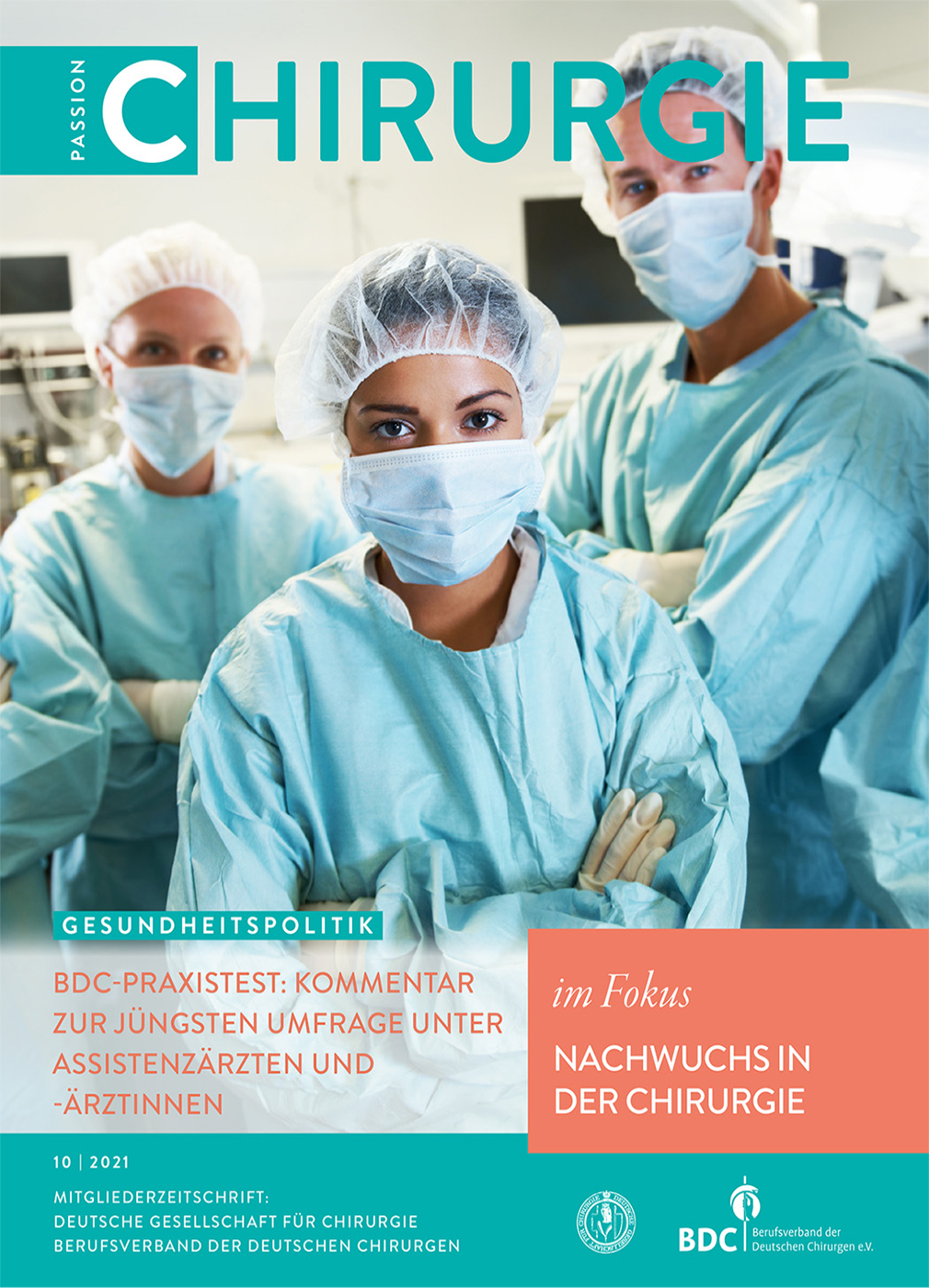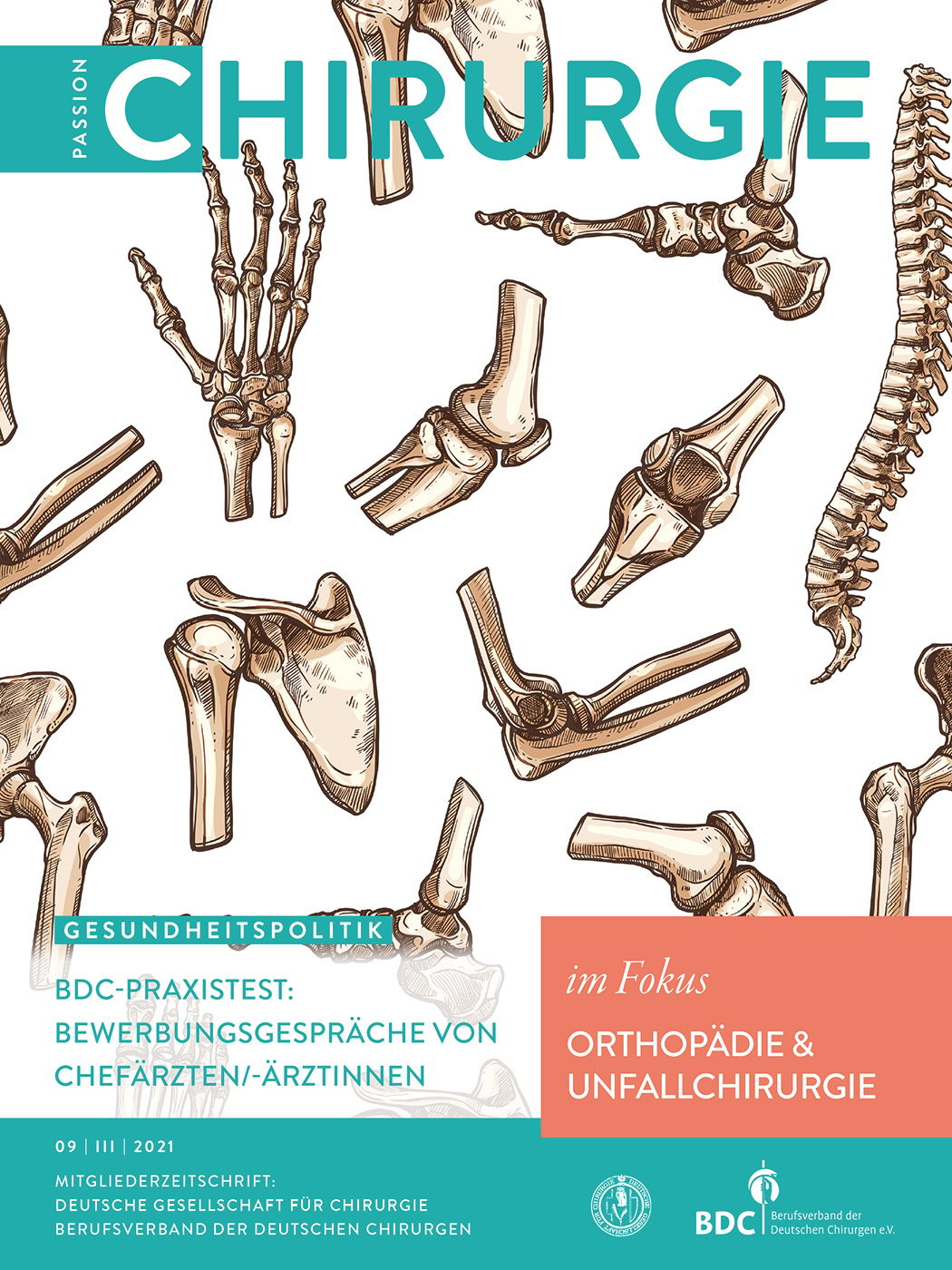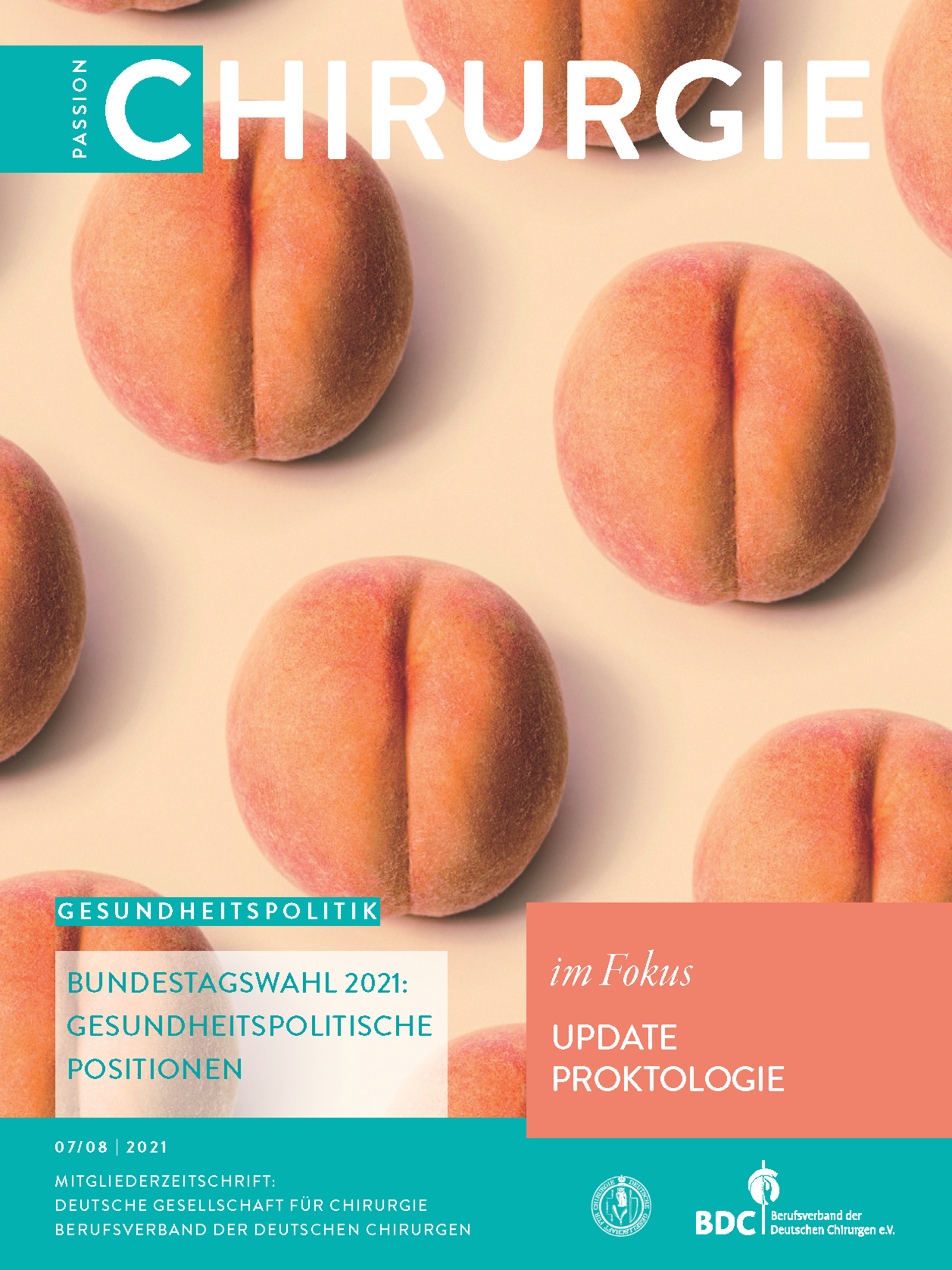01.08.2010 Safety Clip
Safety Clip: Der Medikationsabgleich als Risikopräventionsstrategie

Fall:
Eine 82-jährige Patientin mit Demenzerkrankung wird für einen operativen Eingriff stationär aufgenommen. Da sich in den Überweisungsunterlagen keine Hinweise auf die häusliche Medikation finden, kontaktiert der aufnehmende Arzt die Hausarztpraxis. Die Sprechstundenhilfe faxt eine Liste der Medikamente ans Krankenhaus, wo der Stationsarzt sie weiterverschreibt. Am folgenden Morgen wird die Patientin sehr schwer wach und ihr somnolenter Zustand bessert sich erst im Laufe des Tages. Später stellt sich heraus, dass die gefaxte Medikationsliste veraltet war und das darauf verzeichnete Antidepressivum Amitryptillin schon vor geraumer Zeit abgesetzt wurde. Die im Krankenhaus verabreichte Dosis führte zur Sedierung der Patientin.
Das Erheben einer Medikationsanamnese und die Dokumentation sind essenzielle Bestandteile des Aufnahmegesprächs mit Patienten. Der nächste Schritt ist der Abgleich der bestehenden Medikation mit der im Rahmen der Behandlung zu verabreichenden Medikamente. Höchste Priorität liegt dabei auf der korrekten Verordnung, auf der Kompatibilität der Medikamente untereinander und auf dem Vermeiden von unerwünschten Arzneimittelreaktionen oder „adverse drug events“ (ADEs), die z.B. zu Hämorrhagien, Anaphylaxie, Nierenversagen oder Agranulozytose führen können (Quelle Glossar http://www.psnet.ahrq.gov/glossary.aspx).
Die Information über die aktuelle Medikation des Patienten hat also über verlässliche Quellen und durch gezieltes Nachfragen bzgl. der Aktualität vorliegender Medikationsauflistungen zu erfolgen. In der Fachterminologie des Risikomanagements ist dieser Prozess als „Medication Reconciliation“ bekannt (deutsch: „Medikationsabgleich“).
Definition:
Unter Medikationsabgleich versteht man die mit höchster Sorgfalt geführte Kontrolle der Arzneimittelverschreibung, bei der die bestehende Medikation des Patienten (Dokumentation des Namens, der Dosierung, der Verabreichungsfrequenz und -form) mit der im Rahmen der Behandlung verschriebenen Medikation abgeglichen wird (Quelle: www.ihi.org/IHI/Topics/PatientSafety/MedicationSystems/Tools/Medication+Reconciliation+Review.htm).
Prozess:
- Erheben der Medikation über gesicherte und lesbare Informationsquellen
- Verlässlichkeit der Informationsquelle prüfen
- Auch OTC-Medikamente, homöopathische Mittel und Nahrungsergänzungsmittel erfragen
- Vergleichen der Medikation mit der geplanten Behandlungsmedikation
- Einschätzen der Risiken zur Inkompatibilität und Unverträglichkeit
- Erstellen einer neuen, aktuellen Verordnung der abgeglichenen Medikamente
Der Abgleichungsprozess obliegt dem Arzt und erfolgt bei Aufnahme, Verlegung und Entlassung des Patienten. Ziel ist es, eine verlässliche, geprüfte Medikationsliste bereitzustellen, auf die bei Transfers und Entlassung des Patienten zurückgegriffen werden kann und die anderen Behandelnden eine gesicherte Entscheidungsgrundlage für weitere Verordnungen bietet. Dadurch wird das Risiko für den Patienten, einen Schaden durch Fehlmedikation zu erleiden, gesenkt.
Das Nichtdurchführen eines sorgfältigen Medikationsabgleichs kann verschiedene Ursachen haben: Möglicherweise ist die Verantwortlichkeit nicht geklärt. Soll bereits der notaufnehmende Arzt den Abgleich vornehmen oder der Stationsarzt bei der stationären Aufnahme? Häufig wird auf einen sorgfältigen Abgleich auch aus Zeitgründen verzichtet. Nach rascher Durchsicht der mitgebrachten Medikamententüte, einer handgeschriebenen Liste oder eines alten Arztbriefs wird in der Patientenakte kurzerhand „Hausmedikation weiter“ vermerkt, ohne dass diese Hausmedikation spezifiziert wird. In vielen Krankenhäusern obliegt das Einholen der Informationen zur häuslichen Medikation dem Pflegepersonal, ebenso das Heraussuchen von Äquivalenzpräparaten. Die Richtigkeit der Angaben wird dann jedoch vielfach nicht vom ärztlichen Dienst bestätigt. Auch die kurze Verweildauer der Patienten bei operativen Eingriffen verleitet zum Verzicht auf den Medikamentenabgleich. Erhebliche Risiken für den Patienten sind mitunter die Folge.
Risiken bei Unterlassung eines gesicherten Medikationsabgleichs:
- Reaktion wegen Inkompatibilität der Medikamente
- Unverträglichkeit
- Unerwünschte Zwischenfälle im Rahmen der Narkose
- Undokumentiertes Absetzen von Medikamenten und Vergessen des Wiederansetzens zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. Antikoagulatien, Psychopharmaka)
- Überdosierung bei Doppelverordnung eines Medikaments mit gleichem Wirkstoff, aber anderem Markennamen
Im Gegensatz zur englischsprachigen Literatur ist das Thema in deutschen Studien noch unterrepräsentiert. Nur langsam hält der bewusst durchgeführte „Medikationsabgleich“ Einzug in die Risikomanagementstrategien deutscher Krankenhäuser.
Internationale Studien belegen die mit einem unvollständigen Medikamentenabgleich verbundenen Auswirkungen. Rund 25 % der Fehler bei der Medikamentenanordnung sind laut einer Erhebung zurückzuführen auf einen unvollständig durchgeführten Medikationsabgleich (Quelle: Tam, V.C. et al., 2005, Frequency, type and clinical importance of medication history errors at admission to hospital, a systematic review. CMAJ, August 30; 173[5]). Eine andere Studie ergab bei 54 % der stationären Aufnahmen fehlerhaft erhobene Arzneimittelanamnesen (v.a. Vergessen der Weiterverordnung mindestens eines Medikaments). In 39 % dieser Fälle hatte der Fehler mäßig bis schwere Auswirkungen auf den Patienten (Quelle: Cornish, P.L. et al., Unintended medication discrepancies at the time of hospital admission. Arch Intern Med. 2005; 165: 424-429). Auch im Bereich der Notaufnahme gibt es Zahlen, welche die negative Auswirkung unvollständiger Arzneimittelanamnesen auf den Behandlungsverlauf belegen.
Die Studienergebnisse verlangen nach einem definierten, an die Umstände in der Notaufnahme (Stichwort: Ersteinschätzung) angepassten Verfahren des Medikationsabgleichs (Quelle: Schepherd, G. & Schwartz, R.B., 2009. Frequency of incomplete medication histories obtained at triage. American Journal of Health-System pharmacy, Vol. 66 [1], pp.65-69).
Belegt ist auch, dass ein sorgfältiger Medikamentenabgleich Arzneimittelfehler und unerwünschte Reaktionen auf Medikamentenfehlgaben reduziert. In einer Studie zur Effektivität des Medikationsabgleichs bei Aufnahme auf die Intensivstation mit anschließender Verlegung konnte ein signifikanter Rückgang der Medikationsfehler festgestellt werden (Quelle: Pronovosta, P. et al., 2003, Medication reconciliation: a practical tool to reduce the risk of medication errors, Journal of Critical Care: Vol 18
Autor des Artikels
Angela Herold
GRB Gesellschaft für Risiko-Beratung mbH, MünchenWerner-Eckert-Str. 1181829München kontaktierenWeitere aktuelle Artikel
01.09.2018 Safety Clip
Safety Clip: Aus Fehlern lernen
Kommt es zu einem Schadenfall oder zu einer Beeinträchtigung der Patientensicherheit, wendet sich ein Patient in der Regel mit Schadenersatzforderungen an einen Arzt oder beauftragt gar einen Rechtsanwalt. Die Entscheidung über Zu- oder Ablehnung der Forderung liegt in den Händen der Versicherer.
31.08.2018 Safety Clip
Safety Clip: Lagerungsschäden sind voll beherrschbare Risiken
Die präoperative Positionierung und sachgemäße intraoperative Lagerung des Patienten während der Operation ist eine interdisziplinäre, interprofessionelle Aufgabe und eine gemeinsame Rechtspflicht. Eine sachgemäße Lagerung dient der Sicherstellung der Patientensicherheit und Vermeidung lagerungsbedingter Schäden.
16.08.2018 Recht&Versicherung
Kein Maulkorb für den Arzt! Kommunikation und Verhalten nach einem Schadenfall
Die Verunsicherung in der Ärzteschaft ist groß. Hat die Behandlung nicht den gewünschten Erfolg gebracht, hat sich eine Komplikation verwirklicht oder ist es gar zu einem ernsten Zwischenfall mit einem Schaden für den Patienten gekommen, stellt sich für den Arzt die Frage: Was ist jetzt das richtige Verhalten, ohne für mich persönlich, die Praxis oder das Krankenhaus Nachteile zu schaffen?
01.05.2018 Safety Clip
Safety Clip: Fehlerursachenanalyse am Beispiel einer Seitenverwechslung im OP
Das Thema Patientensicherheit ist heute immanenter Bestandteil der Krankenhausorganisation. Instrumente des Risikomanagements sind implementiert und in der Regel weit entwickelt. So regelt der Einsatz von OP-Sicherheitschecklisten nach WHO-Modell bereits seit circa 15 Jahren die Patientensicherheit bei der operativen Versorgung.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.