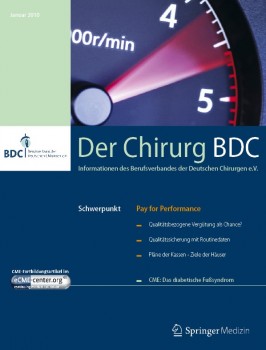01.01.2010 Politik
Qualitätsorientierte Vergütung: Was wäre machbar?

Neue Entwicklungen bei der Messung der Ergebnisqualität eröffnen neue Optionen in der qualitätsorientierten Vergütung. Dabei sind verschiedene Modelle denkbar.
Eine wesentliche Voraussetzung für eine qualitätsorientierte Vergütung oder „Pay for Performance“ (P4P) ist zunächst die sinnvolle Definition von Ergebnisindikatoren. Bisherige Qualitätsdarstellungen, beispielsweise nach den Vorgaben des strukturierten Qualitätsberichts nach §137 SGB V, liefern vielfach keine für P4P verwendbaren Aussagen. Eine Angabe zum Angebot von „MP18 Fußreflexzonenmassage“ im Krankenhaus ist nicht das medizinisch wichtige Kriterium, wonach wir ein Krankenhaus auswählen.
Die Durchführung von „VN01 Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen“ ist auch keine wesentliche Information, die uns bei der Auswahl oder gar Bewertung einer neurologischen Abteilung helfen könnte. Diese zwei nicht sonderlich untypischen Beispiele aus den Vorgaben für den strukturierten Qualitätsbericht verdeutlichen den Informationsnebel, der die medizinisch sinnvolle Qualitätsdiskussion gegenwärtig eher zurückwirft als voranbringt[1].
Aber auch an das zur Veröffentlichung empfohlene BQS-Kriterium „Cholezystektomie: Erhebung eines histologischen Befundes“ würde kaum ein Beteiligter ernsthaft eine erfolgsorientierte Vergütung knüpfen wollen.
Diese Beispiele zeigen, dass eine qualitätsorientierte Vergütung überwiegend auf anderen als den bisher üblichen Kriterien aufsetzen muss. Von P4P-Indikatoren ist Folgendes zu fordern:
- sie sollen aussagekräftig hinsichtlich des Behandlungsergebnisses sein
- sie dürfen nicht auf Selbstreporting beruhen, sondern müssen unabhängig – auch durch den Vertragspartner – messbar sein
- sie müssen möglichst manipulationsresistent sein.
Die Grundlage für die Entwicklung derartiger Indikatoren wurden in den letzten Jahren gelegt. Die Helios Kliniken haben seit 2000 begonnen, Indikatoren für Behandlungsergebnisse mit Hilfe der kodierten Abrechnungsdaten zu ermitteln[2]. Mit dem Wissenschaftlichen Institut der AOK und anderen Beteiligten wurde diese Methodik weiterentwickelt[3]. Über die Kassendaten lassen sich standardisierte mittel- bis langfristige Ergebnisse messen.
Ein erstes Beispiel wären die Revisionsraten von Hüft- oder Knie-TEPs, die über Jahre nach Erstimplantation verfolgt werden können (faktisch können damit bereits jetzt ohne zusätzliche Register und ohne zusätzliche Datenerhebung Kaplan-Meier Kurven zur Überlebensdauer bzw. Revisionsrate von Endoprothesen erstellt werden). Ein weiteres Beispiel der AOK, nämlich die indirekte Messung der Inkontinenzrate nach Prostataoperationen über den entsprechenden Heil- und Hilfsmittelverbrauch nach einem Jahr[4], zeigt, dass selbst ohne explizite Kodierung einer Komplikation aus den vorhandenen Daten sehr sicher auf ihr Vorhandensein geschlossen werden kann.
Der Einwand, diese Daten seien nur zur Abrechnung bestimmt und daher nicht zur Qualitätsmessung geeignet, ist nicht nachvollziehbar. Richtig ist vielmehr, dass gerade die Leistungen, die abgerechnet werden, der Qualitätsprüfung unterliegen müssen. Es kann nicht sein, dass Komplikationen über das CC-System oder die Berücksichtigung von Mehrfachoperationen über die DRGs einerseits abgerechnet werden, andererseits aber in einer separaten Qualitätsmessung möglicherweise „unter den Tisch“ fallen.
Die Integration von Abrechnung und Qualitätsmessung ist daher nicht nur nicht problematisch, sondern vielmehr essentiell einzufordern. Ein immer noch häufig anzutreffendes Missverständnis ist dabei, dass die Qualitätsmessung sich auf die DRGs beziehen würde. Dies trifft nicht zu. Die Qualitätsindikatoren leiten sich, wie die Beispiele zeigen, aus den Diagnose- und Prozedurenschlüsseln, den demographischen Daten oder auch anderen vorhandenen Informationen ab.
Die für die Qualitätsbeurteilung herangezogenen Fallgruppen werden in der Regel nicht mit den DRG-Fallgruppen identisch sein, wohl aber sich auf die gleichen Ausgangsdaten beziehen, die parallel auch für die DRG-Gruppierung genutzt werden. Die sinnvolle Auswahl möglicher Indikatoren ist dennoch wegen der mit einer Anwendung im P4P-Verfahren verbundenen Anreize und möglichen Fehlanreize und der Manipulationsrisiken alles andere als trivial, aber machbar.
Die Entwicklung zeigt, dass die bisher oft übliche Abwehrdiskussion künftig nicht ausreichend sein wird. Die faktische Entwicklung von aussagekräftigen Indikatoren, die erstmals auch ohne Beteiligung der Leistungserbringer messbar sind, wird eine konstruktivere Diskussion erzwingen. An dieser Stelle sollen unter der Annahme, dass aussagekräftige Ergebnisindikatoren zur Verfügung stehen, künftige Optionen für P4P-Systeme aufgezeigt werden.
Das QSR Projekt mit dem AOK Bundesverband hat gezeigt, dass es für viele wichtige Indikatoren eine breite Streuung der Ergebnisse gibt. Gleichzeitig gibt es für die einzelnen Indikatoren, die sich notgedrungen auf möglichst umschriebene medizinische Entitäten beziehen müssen, gerade bei Anbietern mit kleinerer Fallzahl eine erhebliche statistische Messunsicherheit. Diese ließe sich bei einer Zusammenführung der Daten verschiedener Kassen, die aus Sicht des Autors auch aus anderen Gründen sinnvoll wäre, deutlich reduzieren. Allerdings muss die statistische Messungenauigkeit prinzipiell bei der Konzeption von P4P Systemen berücksichtigt werden.
Bei einer Konzeption von P4P sollte ferner beachtet werden, dass das Ziel vor allem in der Schaffung richtiger Anreize zu einer Qualitätsverbesserung bestehen muss. Mögliche P4P Systeme sind daher vor allem unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen. Dabei ist festzuhalten, dass das gegenwärtige stationäre Vergütungssystem nicht qualitätsneutral ist.
Die Schweregradwirksamkeit auch von vermeidbaren Komplikationen, die Berücksichtigung von Mehrfacheingriffen oder die Bezahlung langer Beatmungsdauern führen in vielen Fällen zu einer Vergütung vermeidbarer Ereignisse, d. h. zu einer Belohnung von schlechter Qualität. Dies war und ist mit Sicherheit nicht die Absicht bei der Konstruktion der entsprechenden DRG-Elemente, es ist aber eine Nebenwirkung. Ein System, das den sich daraus ergebenden Fehlanreizen entgegenwirken kann, ist daher überfällig.
Mögliche P4P Ansätze lassen sich wie folgt verkürzt skizzieren:
1. Das Problem der „schwarzen Schafe“
Die Analyse einzelner Qualitätsindikatoren im QSR-Projekt zeigt, dass es fast immer einige wenige signifikant schlechte Anbieter gibt. In der ersten Phase wäre es sinnvoll, gerade die Leistungen dieser Kliniken im Detail zu analysieren, um mögliche Schwachstellen in der Indikatorendefinition aufzudecken (was entsprechende Kooperationsbereitschaft voraussetzt). Es kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass einige tatsächlich schlechtere Anbieter verbleiben werden.
Die Verbesserungen, die dazu geführt haben, dass die Helios Kliniken in den letzten Jahren im Konzernmittel bei vielen Indikatoren beispielsweise Letalitätswerte von 15 bis 30 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt erreichen, sind vor allem auf das entschiedene Angehen identifizierter Probleme in Kliniken mit schlechteren Leistungsbereichen zurückzuführen. Die Elimination solcher Negativausreißer führt zu einer deutlichen Verbesserung der mittleren Qualität. Ob es möglich ist, ähnliche Verbesserungsmethoden auf Bundesebene zu übertragen, erscheint fraglich.
Es ist derzeit keine Institution erkennbar, die bereit wäre, die hiermit einhergehenden Konflikte auch tatsächlich auszutragen. Da das Erkennen von Problemfällen aus ethischer Sicht zum Handeln verpflichtet, wären Maßnahmen zwar im Prinzip angebracht, aber derzeit wohl kaum umsetzbar. Die zu erwartende Abwehrdiskussion (z.B. „schlechtere Risiken“) wäre nur zu umgehen, wenn für die Extremfälle eine Beweislastumkehr (z.B. Nachweis der schlechteren Risiken durch den Anbieter) eingeführt würde.
2. Kontrahieren mit den Besten
Auf dem QMR Kongress in Potsdam wurde deutlich, dass die Krankenkassen bei elektiven Leistungen das weniger konfliktträchtige Modell des Kontrahierens mit den besten Leistungsanbietern bevorzugen[5]. Dem steht derzeit im Wege, dass die Möglichkeiten zur Patientensteuerung begrenzt sind. Außerdem ist dies eine limitierte Option, da selbst gute Anbieter ihr gutes Ausgangsniveau bei starkem Anstieg der Zuweisungen nur schwer werden halten können.
Der oft zu hörende Einwand, die Anbieter würden bei einem solchen Modell nur risikoarme Fälle selektieren, wäre bei diesem Modell weitgehend gegenstandslos, da einerseits eine Kontrolle der Risikostruktur seitens der Kassen möglich ist, andererseits aber gerade in einem Zuweisungsmodell auch mit der vermehrten Zuweisung sogenannter „schlechter Risiken“ zu rechnen ist.
Die Erfahrungen der Helios Kliniken zeigen, dass gerade gute Leistungserbringer nicht deshalb „gut“ sind, weil sie „schlechte Risiken“ nicht behandeln, sondern vor allem deshalb, weil sie bessere Strategien zum Management von Risikopatienten einsetzen.
Das Modell der bevorzugten Kontrahierung mit den besten Anbietern könnte bis auf Weiteres ein von den Krankenkassen bevorzugter P4P-Ansatz sein, weil es am leichtesten umsetzbar ist und naturgemäß kaum Widerstände der direkt Betroffenen auslöst. Die Systemwirkung eines solchen Ansatzes wäre aber gering, da es für die überwiegende Mehrzahl der Anbieter keine Anreize zur Verbesserung gäbe, weil diese den Status des „Besten“ ohnehin nicht erreichen könnten.
3. Nichtbezahlung von Komplikationen
Die Nichtbezahlung von Komplikationen ist als eine P4P-Methode auch in Deutschland bekannt. Sie ist die Grundlage verschiedener Formen der Fallzusammenführung im DRG-System.
Medicare hat diesen Ansatz im letzten Jahr auf Komplikationen innerhalb eines Falles ausgeweitet[6]. Bestimmte nach Katalog definierte Komplikationen im DRG-System, die im alten DRG-System schweregraderhöhend gewirkt haben, werden in Zukunft nicht mehr als vergütungssteigernd anerkannt (z.B. Wegfall der CCL-Bewertung).
Die Vorteile dieses Ansatzes bestehen in einer Kataloglösung, die die Erörterung der Verschuldensfrage im Einzelfall vermeidet, und in positiven Anreizwirkungen zur gezielten Verringerung derartiger Komplikationsraten im Krankenhaus.
Der Nachteil liegt in der Beschränkung auf wenige Komplikationsarten, die entweder völlig vermeidbar sind (sogenannte „Never-events“) oder aber zumindest deutlich reduzierbar sind (beispielsweise Katheterinfektionen). Insofern ist dies ein in der Breite beschränkter Ansatz, der allerdings andere Verfahren sehr gut ergänzen kann.
Ein Sonderfall des „Nonpayment“ Modells sind mittel- bis langfristige Garantien. Solche gab es beispielsweise in der Endoprothetik im Rahmen von integrierten Versorgungsverträgen, die teilweise 5- bis 10-Jahresgarantien eingeschlossen haben. Dem Autor sind allerdings keine Berichte darüber bekannt, ob und in welchem Umfang derartige marketingwirksame Garantieversprechen von den Krankenkassen auch tatsächlich systematisch verfolgt und eingefordert wurden.
Die Transparenz bezüglich früher abgeschlossener Verträge fehlt, sodass bisherige Versuche in dieser Richtung kaum beurteilbar sind. Die QSR-Methodik ändert hier allerdings die Voraussetzungen: Die Kassen könnten solche Garantieversprechen, wenn sie adäquat gestaltet sind, künftig im Routineverfahren automatisiert überwachen.
4. Umfassendere Nichtkontrahierungsmodelle
Insbesondere auf Kassenseite wird bei P4P auch an Vorgehensweisen zur Nichtkontrahierung mit schlechteren Anbietern gedacht, um damit letztlich das in Deutschland seit langem schwelende Problem des Überangebotes an stationären Leistungen lösen zu können. Derartige Ideen belasten aber Ansätze zur Qualitätsverbesserung eher als dass sie nützen.
Zwei Argumente sprechen gegen diese Vorgehensweisen: Erstens sind – abgesehen von den unter Punkt 1 genannten Extremfällen – in einem breiten Mittelfeld die Differenzen zwischen den versorgungsnotwendigen Leistungserbringern oft zu gering, um statistisch hinreichend sicherbar und damit auch justiziabel zu sein.
Zweitens darf die Qualitätssicherung und vor allem -verbesserung kein Instrument zur Lösung von anderweitig verursachten Strukturproblemen im Gesundheitswesen sein, die an anderer Stelle aus politischen Gründen nicht gelöst werden können. Der Versuch der Umwidmung eines an sich sehr vielversprechenden Ansatzes zu diesem Zweck belastet die grundsätzlich notwendigen Massnahmen zur Qualitätsverbesserung und sollte daher unterbleiben.
5. Punktesysteme zur Modifikation der Vergütung
Statt eines „Alles-oder-Nichts“-Systems der Kontrahierung oder Nichtkontrahierung von Leistungen wäre es sinnvoller, bei Qualitätsdifferenzen Zu- und Abschläge zum Basispreis vorzusehen, um damit in der Breite Anreize zu einer intensiveren Beachtung von Ergebnisqualität für möglichst viele Kliniken zu schaffen.
Ein solches System könnte ein Bündel von Indikatoren jeweils mit Punktwerten versehen, die sowohl an das Ergebnis als auch an die Menge gekoppelt sind. Damit würde ein guter Ergebniswert mit zunehmender statistischer Sicherheit auch höher bewertet.
Die Punktzahlen für ein Krankenhaus sollten über die verschiedenen Indikatoren, d. h. auch über die verschiedenen Fachgebiete, zusammengefasst und insgesamt bewertet werden. Damit werden gleichzeitig Anreize zu einer besseren krankenhausinternen Kooperation und interdisziplinärer Zusammenarbeit beim Verbesserungsprozess gesetzt.
Die Gesamtpunktzahl muss auch zur Angebotsbreite des Krankenhauses ins Verhältnis gesetzt werden, da natürlich aufgrund des fachlichen Leistungsspektrums nicht alle Indikatoren in allen Kliniken vorkommen. Der resultierende Wert kann bei Über- oder Unterschreiten des bundesweiten Mittelwertes in einen prozentualen Zu- bzw. Abschlag auf den Basisfallwert des Krankenhauses umgerechnet werden. Der bundesweite Mittelwert ließe sich bei Qualitätsindikatoren auf der Basis von Routinedaten schon jetzt anhand vorhandener Datenbestände ermitteln.
Erfahrungsgemäß würden bereits Zu- bzw. Abschläge in der Größenordnung von +/- 2 bis 3 Prozent erhebliche Anreizwirkungen entfalten (die Extremwerte werden in diesem Modell praktisch kaum erreicht). Ein solches System wäre wirksam, da in den gegenwärtigen Pflegesatzverhandlungen erfahrungsgemäß schon geringere Budgetmodifikationen zu merklichen Verhaltensänderungen der Kliniken führen. Es wäre gesetzlich formulierbar und systematisierbar und somit auch auf Bundesebene anwendbar. Dieser Ansatz ähnelt übrigens den internen Bonussystemen, die die Helios Kliniken in den letzten Jahren mit erheblichem Erfolg angewendet haben.
Der Vorteil eines solchen Systems läge darin, dass bei geeigneter Wahl der zugrunde liegenden Indikatoren für alle Kliniken Anreize zu einer Verbesserung der Qualität geschaffen würden. Gleichzeitig würde durch die Höhe der Zu- und Abschläge keine Klinik in der Existenz gefährdet. Dies unterscheidet diesen Ansatz von den unter 1., 2. und 4. diskutierten Varianten.
Erfahrungsgemäß wird gegen ein solches System der Einwand erhoben werden, dass es zur Risikovermeidung führen würde. Dieser Einwand unterschätzt einerseits die Qualität der Indikatoren und ignoriert auch die erheblichen Möglichkeiten zur tatsächlichen Qualitätsverbesserung, da er mittelbar unterstellt, dass Qualitätsunterschiede nur auf Risikodifferenzen zurückzuführen wären.
Dies trifft leider nicht zu. Andererseits wäre eine Risikoverlagerung zu kompetenteren Anbietern, bei denen die „Risikopatienten“ wegen eines adäquaten Managements oft nicht zu einer Verschlechterung der Ergebnisindikatoren führen, schon für sich eine Maßnahme zur Qualitätsverbesserung. Wie Prof. Michael Heberer richtig kommentierte: „Ich finde es wünschenswert, dass periphere, kleinere Spitäler Risikopatienten an uns weiterschicken. Ein schwer kranker Patient mit vielen Risiken gehört nicht in einem kleinen Bezirkshospital operiert. Die Selektion, die stattfindet, führt also zu einer gewünschten Verschiebung von Hochrisikopatienten in die Spitäler der Maximalversorgung.“ [7]
6. Integrierte und regionale Versorgung
Es sei angemerkt, dass die Langzeitindikatoren des QSR-Projektes auch die integrierte, sektorübergreifende Beurteilung der Qualität einer gesamten Versorgungskette oder Region erlauben. Ferner könnten auf Bundesebene auch die Ergebnisse verschiedener Verfahren verglichen werden. Die sich daraus ergebenden, sehr weit reichenden Möglichkeiten sollen an dieser Stelle nicht näher erörtert werden.
P4P und selektives Kontrahieren
Die Krankenkassen sehen die Qualitätsdiskussion derzeit oft im Zusammenhang mit dem selektiven Kontrahieren. Dies ist aus ihrer Sicht verständlich, da eine überzeugende Qualitätsstrategie einen Wettbewerbsvorteil darstellen könnte. Gegen die Verbindung einer Ziele setzenden, qualitätsorientierten Vergütung mit dem selektiven Kontrahieren sprechen allerdings fachliche Argumente. Medizinische Qualität für ein Krankheitsbild setzt heute in vielen Fällen ein einheitliches, strukturiertes, an Leitlinien orientiertes Handlungskonzept voraus.
Die Behandlung der Patienten muss sich dabei an ihrer medizinischen Ausgangssituation orientieren und nicht an ihrer Kassenzugehörigkeit. Es ist schwer genug, eine vernünftige Qualitätsstrategie in einem Krankenhaus durchzusetzen. Mehrere, womöglich kassenabhängig an unterschiedlichen Zielen orientierte Strategien sind nicht sinnvoll und praktisch auch nicht umsetzbar. Es wäre zu befürchten, dass daraus eher Marketinggimmicks entstünden, die eine nachhaltige Qualitätsverbesserung aufgrund der Zersplitterung der Anreizwirkungen eher beeinträchtigen als fördern würden.
Zusammenfassung
Die vorgegebene Kürze des Artikels erlaubt nur eine knappe Darstellung des Themas. Dennoch sollte erkennbar werden, dass sich mit den neugeschaffenen Möglichkeiten zur Messung von Ergebnisqualität auch Optionen für die Einführung von qualitätsorientierten Vergütungselementen ergeben. Für die Ärzteschaft ist es wichtig zu erkennen, dass Qualitätsmessungen in Zukunft aufgrund der technischen Entwicklungen auch ohne ihr Mitwirken erfolgen können. Die Krankenkassen haben hier gegenwärtig sogar aufgrund der Möglichkeit, auf Langzeitdaten zugreifen zu können, einen Informationsvorsprung.
Die Krankenkassen bevorzugen derzeit selektive Kontrahierungsmodelle. Deren Möglichkeiten sind aber begrenzt und sie führen nicht zu umfassenden Anreizwirkungen hinsichtlich einer systemweiten Qualitätsverbesserung. Aus Sicht des Autors wäre daher ein systematischer Ansatz im Sinne eines (unter 5. diskutierten) Punktesystems zu bevorzugen. Dieser ließe sich in das gegenwärtige Vergütungssystem integrieren und würde bei richtiger Ausgestaltung bundesweit medizinisch sinnvolle Anreize für eine systemweite Qualitätsverbesserung schaffen.
Literatur
[1] Krause, T. Qualität 3.0, Randnotiz. Dtsch Arztebl 2009; 106(38): A-1815
[2] Vgl. z.B. HELIOS Kliniken. Medizinischer Jahresbericht 2005. Fulda/Berlin: HELIOS Kliniken, 2006
[3] AOK-Bundesverband, Forschungs- und Entwicklungsinstitut für das Sozial- und Gesundheitswesen Sachsen-Anhalt (FEISA), HELIOS Kliniken, Wissenschaftliches Institut der AOK (WIdO). Qualitätssicherung der stationären Versorgung mit Routinedaten (QSR) – Abschlussbericht. Bonn: WIdO, 2007
[4] Grether T. Informationsmonopol der Kliniken gefallen. Die GesundheitsWirtschaft 6(3):39-42
[5] Vgl. u.a. Göbel T. Erfahrungen und Konzepte der AOK Hessen. Deutsche Medizinische Wochenschrift 2009. S8:S317
[6] Valuck T. Medicare Value-Based Purchasing: Non-Payment for Selected Hospital-Acquired Conditions. Deutsche Medizinische Wochenschrift 2008. 37:S140-S143
[7] (Kein Autor) Mehr Indikatoren, bitte! kma 2008. 2 (140): 52-57
Autor des Artikels
Dr. Thomas Mansky
HELIOS KlinikenBerlinWeitere Artikel zum Thema
17.09.2024 Politik
Orientierungswert steigt um 3,85 Prozent
Der Bewertungsausschuss (BA) hat in den jährlichen Finanzierungsverhandlungen eine Erhöhung
01.09.2024 Einsatz- und Katastrophenmedizin
Chirurgische Herausforderungen bei der Landes- und Bündnisverteidigung
Chirurgie bei der Landes- und Bündnisverteidigung (LV/BV) – wer hätte gedacht, dass wir uns als Chirurgen nun so intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen müssen? Aber nachdem die Krim 2014 von Russland annektiert wurde, 2015 dann die Besetzung einiger Ostgebiete der Ukraine von Russland erfolgte und im April 2022 die Ukraine von Russland in einem klassischen konventionellen Krieg überfallen wurde, musste uns allen spätestens zu diesem Zeitpunkt klar werden, dass sich die Europäische Sicherheitslage und auch die Sicherheitsordnung dramatisch verändert hatten.
01.09.2024 Orthopädie/Unfallchirurgie
Notfallmedizin in Deutschland
Die Notfallmedizin in Deutschland wird in ersten Aufzeichnungen bereits im späten 19. Jahrhundert erwähnt, wobei sich ein organisiertes Rettungswesen erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.