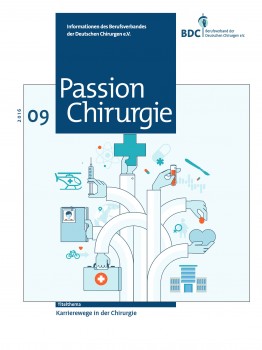Es gibt wohl kaum ein Thema, das während des Medizinstudiums emotional so belastet wie die Promotion. Viele Arbeiten finden ihren grandiosen Abschluss mit der Verleihung der Doktorwürde durch die medizinische Fakultät. Ein wirklich erhebender Moment, für den allein sich der Aufwand lohnt. Aber bei einem nicht gerade kleinen Teil der Studierenden sitzt der Schrecken dieser Arbeit auch nach erfolgreichem Abschluss noch in den Gliedern, sodass die Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens unter den Medizinstudierenden nach wie vor kontrovers diskutiert wird. Verlässliche Zahlen, wie hoch der Anteil der Studierenden ist, die sich auf das Abenteuer Promotion einlassen und dann erfolgreich abschließen, gibt es nicht. Dabei ist der Anteil der Studierenden mit abgeschlossener Promotion in der Medizin deutlich höher als in allen anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen.
Motivation: Qualifikationsmerkmal oder zwei Buchstaben am Praxisschild
Lohnt es sich überhaupt noch eine Promotion anzustreben, obwohl der gegenwärtige Arbeitsmarkt den Berufseinsteigern doch alle Tore zu öffnen scheint? Die Antwort auf diese Frage vieler Studierenden ist ein klares Ja. Eine erfolgreich abgeschlossene Doktorarbeit ist und bleibt ein Qualifikationsmerkmal der persönlichen beruflichen Weiterbildung, die von den Arbeitgebern als Teil des Lebenslaufes nach wie vor hoch eingeschätzt wird. Die Promotionsarbeit hebt den akademischen Anspruch des berufstätigen Arztes hervor und ist ein Wettbewerbsvorteil um lukrative Weiterbildungsstellen. Dies gilt für alle medizinischen Fachdisziplinen. Für einige Laufbahnen in der Medizin wird die Doktorarbeit immer noch vorausgesetzt. Warum auch sollte sich ein Absolvent einer medizinischen Hochschule glaubhaft für eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Universitätsklinik interessieren, wenn die akademische Motivation nicht einmal für die Promotionsarbeit reicht? Selbstverständlich, nicht jeder Medizinstudierende will an einer Universität arbeiten. Aber ein Praxisschild nach Niederlassung ohne diese beiden Buchstaben vor dem Namen macht so manchen Patienten skeptisch. Der ist ja nicht einmal Doktor! Und der nicht-promovierte Oberarzt an einer großen Versorgungsklinik hat es gegenüber den zunehmend hohen Versorgungsansprüchen der Patienten auch nicht leichter. Ob es berechtigt ist oder nicht – der Doktortitel vermittelt Kompetenz und schafft Vertrauen.
Wer sich also für eine Doktorarbeit entscheidet, sollte möglichst frühzeitig im Studium mit diesem Kapitel beginnen. Das bedeutet, nach dem Physikum anfangen, die Fühler auszustrecken und die ersten Informationen zu sammeln. An einigen Universitäten sieht die Promotionsordnung verpflichtende Vorbereitungskurse als Voraussetzung für die Aufnahme des Promotionsverfahrens vor. Diese können problemlos in die ersten beiden klinischen Semester eingebaut werden. Auch lohnt es sich, die wissenschaftlichen Schwerpunkte und deren personelle Struktur an der eigenen Universität zu erkunden, damit klar wird, auf was und wen man sich einlässt.
Die Qual der Wahl: Der richtige Typ der Promotionsarbeit
Grundsätzlich gibt es aus Sicht des Doktoranden drei Typen von Promotionsarbeiten, zwischen denen er sich entscheiden muss, und alle haben ihre eigenen Tücken. Am aufwendigsten ist sicherlich die experimentelle Laborarbeit, alleine schon weil eine Methodik erlernt werden muss, bevor es dann in den eigentlichen experimentellen Teil geht. Wer aber jetzt schon weiß, dass nur die universitäre Laufbahn in Betracht kommt und das Thema der Doktorarbeit auch noch in die spätere Fachdisziplin fällt, findet hier seinen Platz. Es lohnt sich unter diesen Umständen sogar ein zusätzliches Semester einzuplanen. Bei keiner anderen Arbeit ist man so intensiv in ein oftmals kleines Team eingebunden, bei keiner anderen Promotion arbeitet der Doktorand so eng mit seinem Betreuer zusammen.
Der zweite Typ einer Dissertation ist die prospektive klinische Beobachtungsstudie, die oftmals den großen Vorteil hat, dass ein fertiges Studienprotoll existiert und das gesamte Studiensetting inklusive Finanzierung und Ethikantrag bereits besteht. Auf den ersten Blick scheint dabei oft alles gut durchdacht, aber das Problem kann bei genau definierten Ein- und Ausschlusskriterien die ausreichende Akquise von Studienpatienten sein. Und die kann das Ende der Promotionsarbeit nicht unerheblich in die Länge ziehen, sodass dieser Punkt mit dem Doktorvater explizit besprochen werden muss.
Der Klassiker unter den Promotionsarbeiten ist die retrospektive Analyse einer Patientenkohorte. Auch hier ist die sorgfältige Planung das A und O. Das, was auf den ersten Blick wie ein Selbstläufer aussieht, kann sich später als große Mogelpackung entpuppen. Die meisten abgebrochenen Doktorarbeiten finden sich daher in dieser Sparte. Ursache dafür ist oft, dass Daten, die zur Analyse zunächst zusammengestellt werden müssen, nicht zu finden sind oder – noch schlimmer – gar nicht existieren. So besteht die wichtigste Aufgabe des Doktoranden und seines Betreuers darin, vorab das zu analysierende Krankengut hinsichtlich der Fragestellung genau zu definieren und zu überprüfen, ob die Daten hierfür zur Verfügung stehen. Es lohnt sich also, vorab einen Blick in die elektronischen Datenbanken, Archive oder Patientenakten zu werfen, bevor eine solche Arbeit den Zuschlag erhält.
Berufsalltag: Trauriges Aus der Promotion vermeiden
Bei allen Überlegungen, welche Arbeit die Richtige ist, gilt zu bedenken, dass am Ende nur die abgeschlossene Promotion zählt. Bei der zeitlichen Planung muss angestrebt werden, dass die Promotionsarbeit mit dem Ende des Praktischen Jahres beim Dekanat auf dem Tisch liegt. Denn die Erfahrung zeigt, dass in den ersten Jahren des Berufslebens Zeit knapp ist – erst recht für eine Promotionsarbeit. Die Motivation, die Promotionsarbeit zum Abschluss zu bringen, ist als Assistenzarzt im Common Trunk auf dem absoluten Tiefpunkt und so manche Arbeit findet hier ihr trauriges unvollendetes Aus.
Zentraler Punkt: Zusammenarbeit zwischen Betreuer und Doktorand
Um all diese drohenden Pannen sicher zu vermeiden, ist der Betreuer der Doktorarbeit der zentrale Punkt. Aber wie den richtigen finden? Eines sollte der Studierende wissen: Für den Doktorvater muss die Betreuung einer Promotionsarbeit einen nachweislichen Nutzen haben, altruistische Motive sind eher selten anzutreffen. In der Regel ist die Publikation, der im Rahmen der Doktorarbeit erhobenen Daten, in einem Fachjournal das angestrebte Ziel und der Doktorand übernimmt die ehrenvolle Aufgabe, diese Daten – in welcher Art auch immer – zusammenzustellen. Der Doktortitel ist aus Sicht des Betreuers nur ein löbliches Nebenprodukt. Der Pakt, der mit seinem Doktorvater eingegangen wird, muss von gegenseitigem Respekt und Vertrauen geprägt sein, denn beide brauchen einander. Einige Universitäten machen mit ihren Doktoranden zusätzlich zu den mündlichen Absprachen einen Promotionsvertrag mit klar umschriebenen Aufgaben der beiden Partner. Dennoch ist bei der Wahl der Arbeit und damit des Betreuers eine gehörige Portion Bauchgefühl mit im Spiel. Entscheidend ist, dass der Doktorvater einen zuverlässigen Eindruck und Interesse an dem Projekt vermittelt. Ein Betreuer, der regelmäßig Termine zur Vorbereitung absagt, noch schlimmer vergisst, und seine zugesagten Aufgaben in der Projektplanung nicht zeitgerecht und ernsthaft wahrnimmt, ist in dubio nicht der richtige Mann. Bei der inhaltlichen Vorbereitung der Dissertation ist ein Aspekt entscheidend – die Fragestellung. Was genau ist das Thema der Promotionsarbeit? Diese Frage zu beantworten ist die Kernaufgabe des Betreuers und wenn er diese nicht unmissverständlich definieren kann, ist kein gutes Ende zu erwarten. Deshalb sollte vorab für alle Promotionsarbeiten ein kurzes Studienprotokoll erarbeitet werden, in der die Kernelemente Studientyp, Fragestellung und Methodik niedergeschrieben sind. Das hilft allen Beteiligten, sich ein klares Bild von dem Projekt zu machen, setzt allerdings voraus, dass sich der Studierende in die Thematik mit der entsprechenden Literatur einliest. Das ist am Anfang sicherlich mühsam, aber unumgänglich und steht eigentlich immer am Anfang des ganzen Projektes.
Trotz aller möglichen Schwierigkeiten ist die Promotionsarbeit aber auch ein unglaublich spannender Teil des Medizinstudiums. Erstmalig gibt es die große Gelegenheit, sich mit einer medizinischen Thematik und Methodik in ihrer unendlichen Tiefe zu beschäftigen und sich dabei Fachwissen in einem hoch-spezialisierten Sektor zu erarbeiten, welches die ganze Faszination der Medizin offenlegt. Neben dem Erwerb des Doktortitels ist das der eigentliche Gewinn, den man sich nicht entgehen lassen sollte.