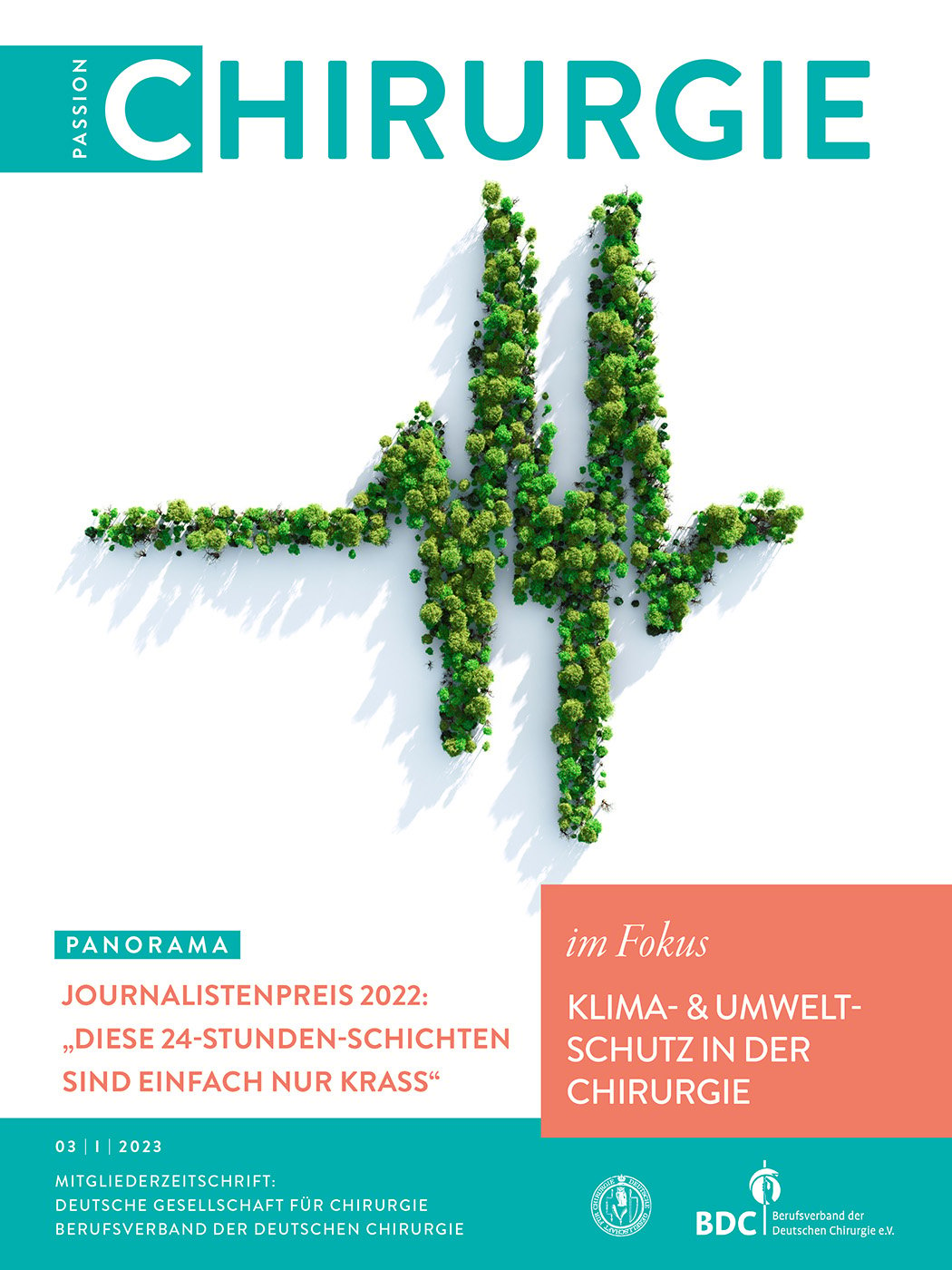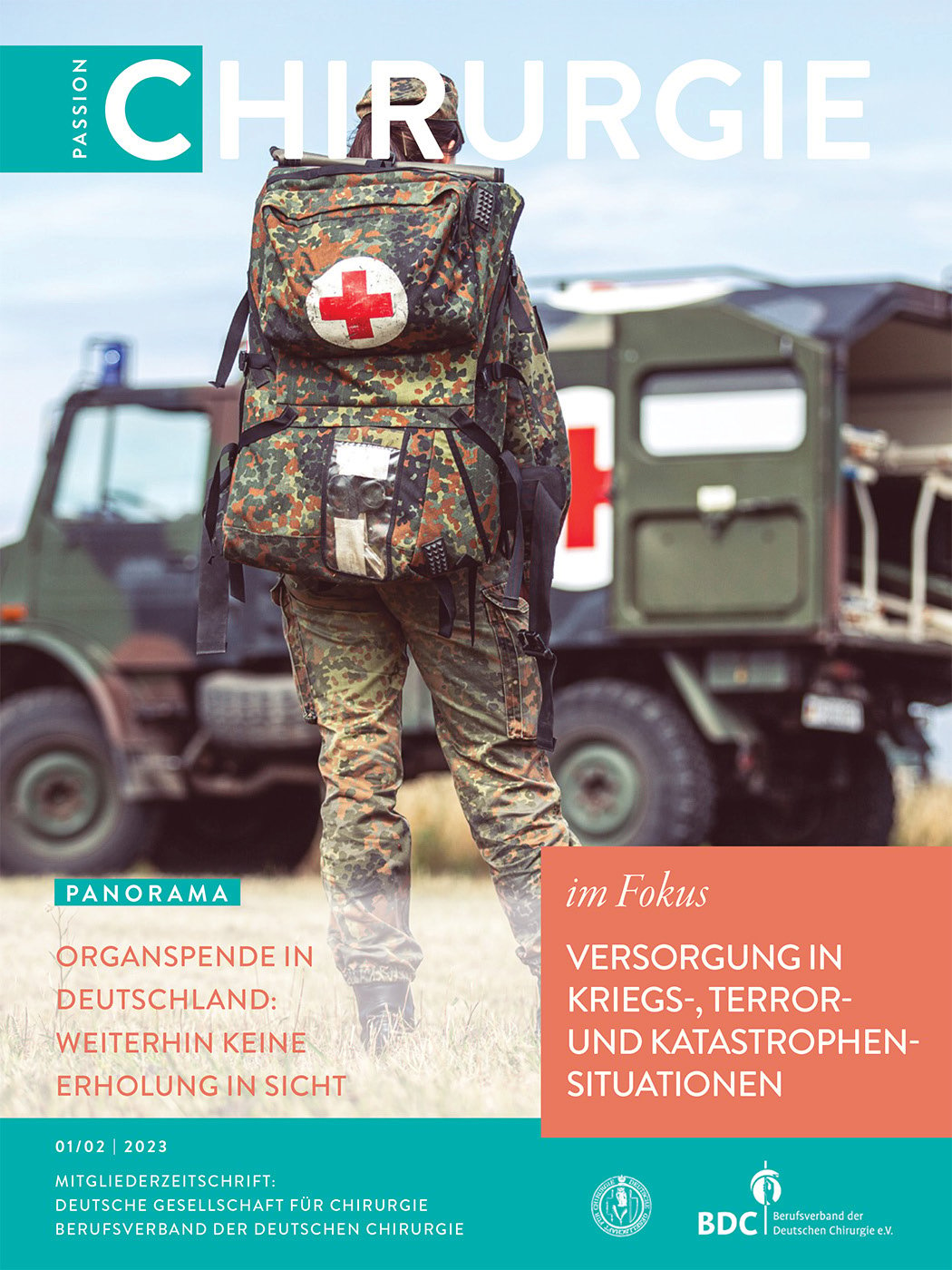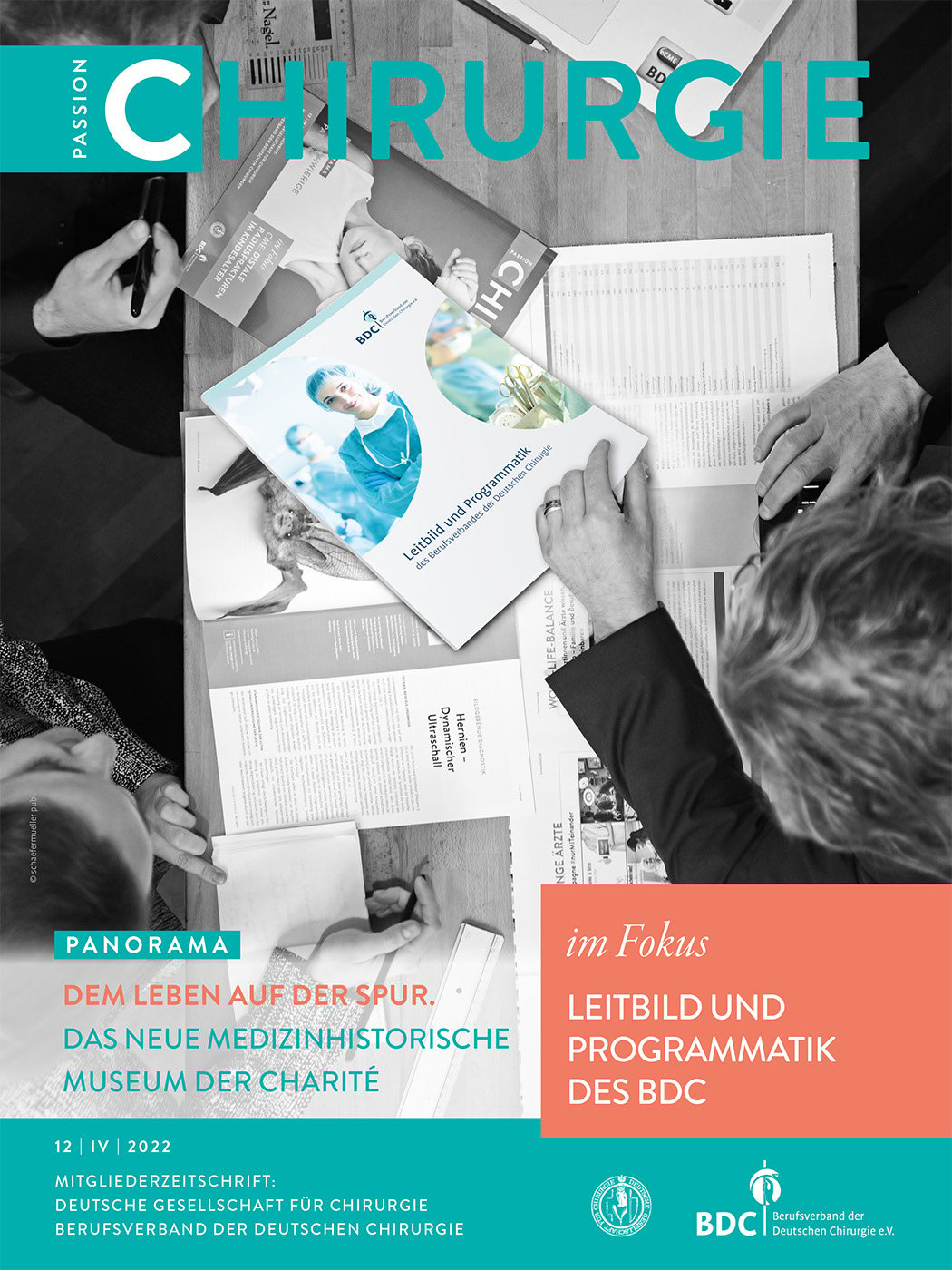14.06.2018 Politik
Fünf Forderungen zur Digitalisierung im Gesundheitswesen

Digitalisierung (rechts-)sicher und zum Nutzen der Versicherten und Patienten gestalten
Die ehrenamtlich tätigen Versicherten- und Arbeitgebervertreter der Ersatzkassen (Techniker Krankenkasse (TK), BARMER, DAK-Gesundheit, KKH Kaufmännische Krankenkasse, hkk – Handelskrankenkasse, HEK – Hanseatische Krankenkasse) haben in der Mitgliederversammlung des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek) ein Positionspapier zur Digitalisierung im Gesundheitswesen verabschiedet.
In diesem werden fünf Forderungen formuliert, die vom Umgang mit Gesundheits-Apps bis hin zur Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur und zur Sicherung des Datenschutzes reichen. In dem Papier heben die Selbstverwalter den Wert von digitalen Anwendungen als Baustein des medizinischen Fortschritts hervor. „Digitalisierung bietet die Chance, zu einer besseren Gesundheitsversorgung beizutragen und die Lebensqualität vieler Patientinnen und Patienten zu verbessern“, betonte Uwe Klemens, Verbandsvorsitzender des vdek.
Gleichzeitig müssten aber auch die Risiken digitaler Anwendungen sorgfältig beachtet werden. E-Health- und Big-Data-Anwendungen müssten gezielt und überlegt im Sinne der Versicherten eingesetzt werden. „Im Mittelpunkt muss der Nutzen für die Versicherten und die Patienten stehen“, sagte Klemens. Der Schutz der individuellen Daten und das Recht des Einzelnen auf informationelle Selbstbestimmung habe zudem oberste Priorität.
Die fünf Forderungen (zusammengefasst):
1. Telematikinfrastruktur ist zentraler Grundpfeiler: Durch die Telematikinfrastruktur werden Ärzte, Psychotherapeuten, Zahnärzte, Krankenkassen, Krankenhäuser, Apotheken und perspektivisch auch weitere Player des Gesundheitswesens wie die Pflege, sicher und geschlossen vernetzt. Die Ersatzkassen unterstützen die zügige Einführung der nutzbringenden Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte (eGK), wie die elektronische Patientenakte bzw. das elektronische Patientenfach, den Notfalldatensatz und den eMedikationsplan. Technische Standards und Schnittstellen müssen einheitlich und klar definiert werden. Versicherte sollen in Zukunft auch über Mobilgeräte Anwendungen (etwa die Einsicht in die Notfalldaten, den eMedikationsplan oder das elektronische Patientenfach) nutzen können.
2. Digitale Gesundheitsanwendungen (Apps) sicher nutzen: Bei den zahlreich auf dem Markt befindlichen Gesundheits-Apps muss unterschieden werden zwischen Lifestyle-Apps und Apps mit medizinisch unmittelbar relevanten Funktionen. Eine App ist unter anderem dann als Medizinprodukt einzustufen, wenn sie der Initiierung oder Steuerung medizinischer Therapien dient, wenn mit ihrer Hilfe medizinische Diagnosen erstellt werden oder ihre Anwendung einer Screening- oder Präventionsmaßnahme gleichkommt. Um mehr Transparenz zu schaffen, sollte eine unabhängige frei zugängliche Datenbank für solche Apps errichtet werden. Die Nutzung von Digital-Health-Anwendungen muss für alle Versicherten freiwillig sein, und die Datensammlung ebenso wie die Löschung bedarf der Zustimmung des Versicherten. Gesundheits-Apps dürfen nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt werden, so z. B. für indirekte Werbung für bestimmte Produkte, Präparate oder Medikamente.
3. Telemedizin zur Versorgungsverbesserung stärken: Die Ersatzkassen erhoffen sich von telemedizinischen Anwendungen Verbesserungen der Versorgung und sehen auch Chancen für mehr Wirtschaftlichkeit. Telemedizin kann dazu beitragen, die Herausforderungen des demographischen Wandels zu bewältigen und die Versorgungssituation in ländlichen Räumen zu verbessern. Telemedizinische Projekte werden unter Mitwirkung der Ersatzkassen derzeit im Rahmen des Innovationsfonds erprobt. Die Ersatzkassen setzen sich dafür ein, dass digitale Versorgungsangebote mit nachgewiesenem Nutzen zu einem festen Bestandteil der Leistungen der GKV werden. An telemedizinischen Anwendungen sind jedoch die gleichen Anforderungen zu stellen wie bei der Einführung anderer Leistungen in die Regelversorgung. Dringend nötig ist der Breitbandausbau, damit in ganz Deutschland stabile Internetverbindungen zur Verfügung stehen, etwa für die Videosprechstunde. Zudem sind haftungs- und datenschutzrechtliche Fragen an übergeordneter Stelle zu klären, um für Arzt und Anwender die notwendige Rechtssicherheit zu schaffen. Die Ersatzkassen begrüßen, dass das Fernbehandlungsverbot durch den 121. Deutschen Ärztetag gelockert wurde. Die Umsetzung dieses Beschlusses durch die Landesärztekammern sollte zeitnah erfolgen.
4. Datenverfügbarkeit zur Verbesserung der Versorgung erleichtern: Die rechtlichen Möglichkeiten der Krankenkassen, auf Basis von Routinedaten die Versorgung zu verbessern, sind heute durch rechtliche Hürden stark eingeschränkt. So dürfen derzeit die Abrechnungsdaten von ärztlichen (zum Beispiel eine Operation) und ärztlich veranlassten Leistungen (zum Beispiel ein Medikament) nicht zusammengeführt werden. Damit Krankenkassen besser in der Lage sind, datengestützte und damit bedarfsgerechte Beratungs- und Versorgungsangebote für die Patienten zu entwickeln, müssen die Regelungen – unter strenger Beachtung des Datenschutzes und Wahrung der persönlichen Rechte der Versicherten – erweitert werden. Dies gilt etwa für die Erhebung zusätzlicher Patientendaten, z. B. im Rahmen von Versorgungsforschung. Darüber hinaus sollten Löschfristen verlängert werden, um langfristige Analysen (etwa bei chronischen Erkrankungen oder Tumorleiden) zu ermöglichen. Zu jeder Zeit muss der Patient Herr seiner Daten bleiben und sich über die Analyseergebnisse informieren können.
5. Verwaltungsmodernisierung und Serviceverbesserung: Die Digitalisierung wird in vielen Verwaltungsbereichen zur Vereinfachung und Modernisierung beitragen. Im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten bieten die Ersatzkassen ihren Versicherten schon diverse digitale Kommunikationsmöglichkeiten an, etwa per Online-Portal oder Service-App. Zudem verfügen sie über ein langjähriges und profundes Wissen, was den effizienten und sicheren Datenaustausch zwischen den Akteuren im Gesundheitswesen (Arbeitgeber, Krankenkassen, Leistungserbringer u. a.) anbelangt. Um die Kommunikation einfacher und effizienter zu gestalten, sollte der Gesetzgeber die entsprechenden Regelungen überprüfen und anpassen. Dazu gehört die rechtssichere Authentifizierung der Versicherten auch auf dem elektronischen Wege (z. B. per Videotelefonie), wie sie auch bei Banken praktiziert wird.
Die ausführlichen Grundsätze finden Sie unter folgendem Link: www.vdek.com/presse/pressemitteilungen.html
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) ist Interessenvertretung und Dienstleistungsunternehmen aller sechs Ersatzkassen, die zusammen nahezu 28 Millionen Menschen in Deutschland versichern:
- Techniker Krankenkasse (TK)
- BARMER
- DAK-Gesundheit
- KKH Kaufmännische Krankenkasse
- hkk – Handelskrankenkasse
- HEK – Hanseatische Krankenkasse
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) wurde am 20. Mai 1912 unter dem Namen „Verband kaufmännischer eingeschriebener Hilfskassen (Ersatzkassen)“ in Eisenach gegründet. Bis 2009 firmierte der Verband unter dem Namen „Verband der Angestellten-Krankenkassen e. V.“ (VdAK).
In der vdek-Zentrale in Berlin sind mehr als 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. In den einzelnen Bundesländern sorgen 15 Landesvertretungen mit insgesamt rund 340 sowie mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegestützpunkten für die regionale Präsenz der Ersatzkassen.
Quelle: Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek), Askanischer Platz 1, 10963 Berlin, www.vdek.com, 14.06.2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Weitere aktuelle Artikel
27.07.2025 Politik
Der BDC im Interview mit Gesundheitsminister Dr. Philippi
Mit Interesse verfolgen wir über Ihren Presseversand, wie Sie Ihre Krankenhäuser im Rahmen des Krankenhaus-Investitionsprogramms 2024 unterstützen. Wie geht es damit voran? Welcher Art von Krankenhäusern in Niedersachsen kommt das Programm zugute? Wie möchten Sie grundsätzlich die zukünftige Finanzierung des Gesundheitssystems und der Krankenhäuser in Ihrer Region sichern?
18.07.2025 Politik
G-BA nimmt Liposuktion nach positiver Nutzenbewertung in den regulären Leistungskatalog auf
Operative Behandlung des Lipödems zeigt Erfolg.
15.07.2025 Politik
Notfallstrukturen – Übergangsregelung für die gestuften Anforderungen an das vorzuhaltende Fachpersonal gilt bis Ende 2025
Der G-BA hat Anpassungen vorgenommen.
17.06.2025 Gesetzgebungsverfahren
Vorhabeplanung des BMG
17 große und kleinere Themen stehen auf der Liste.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.