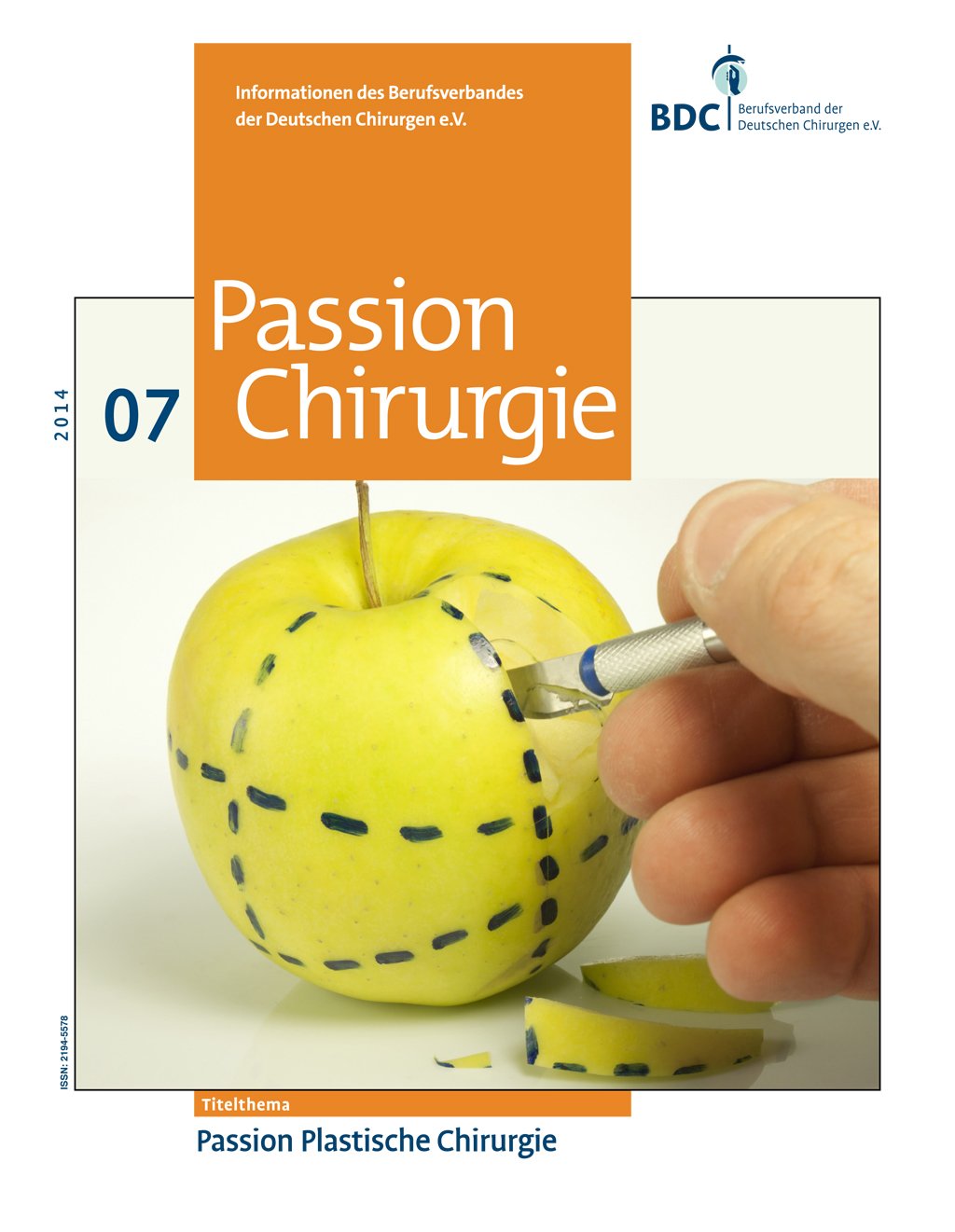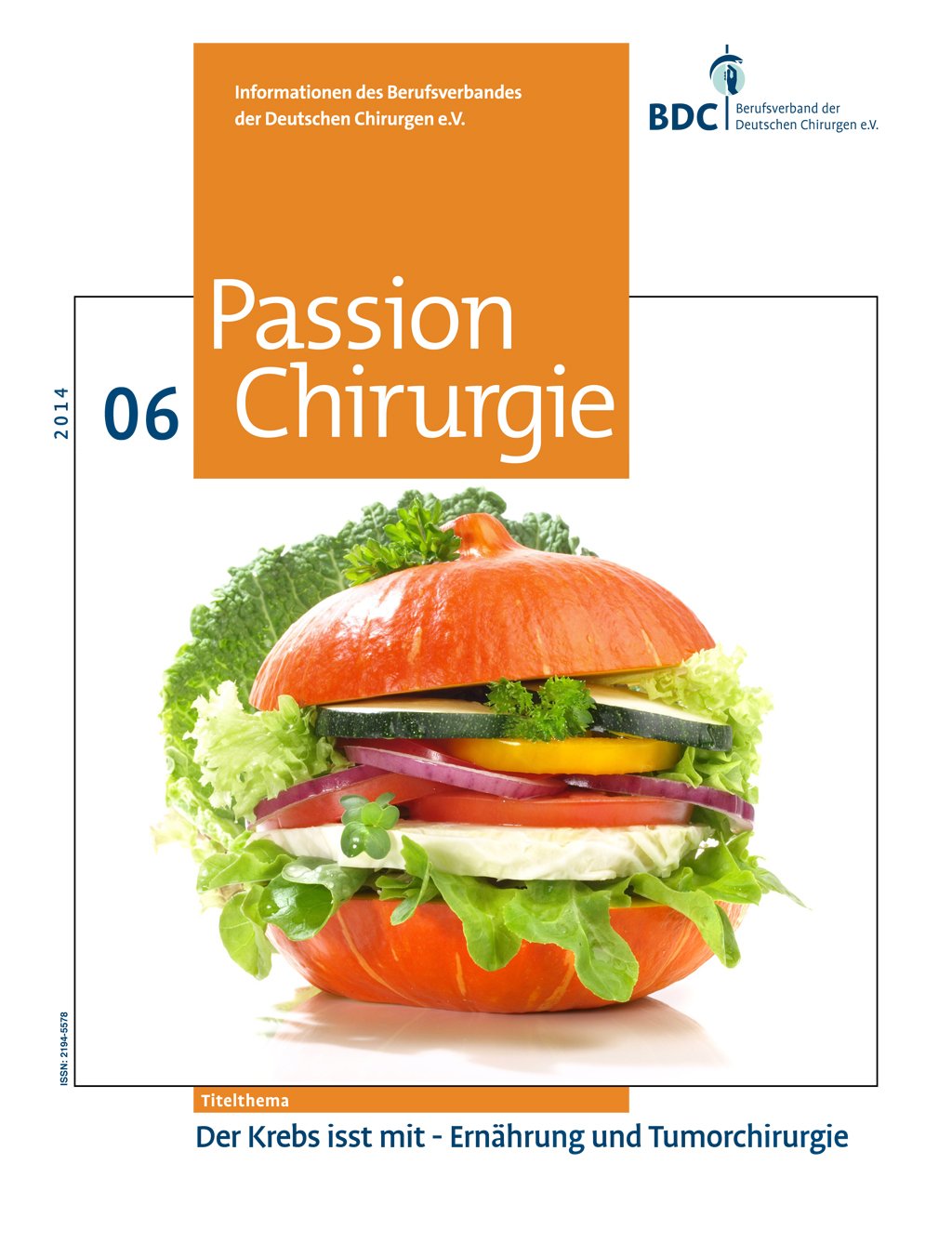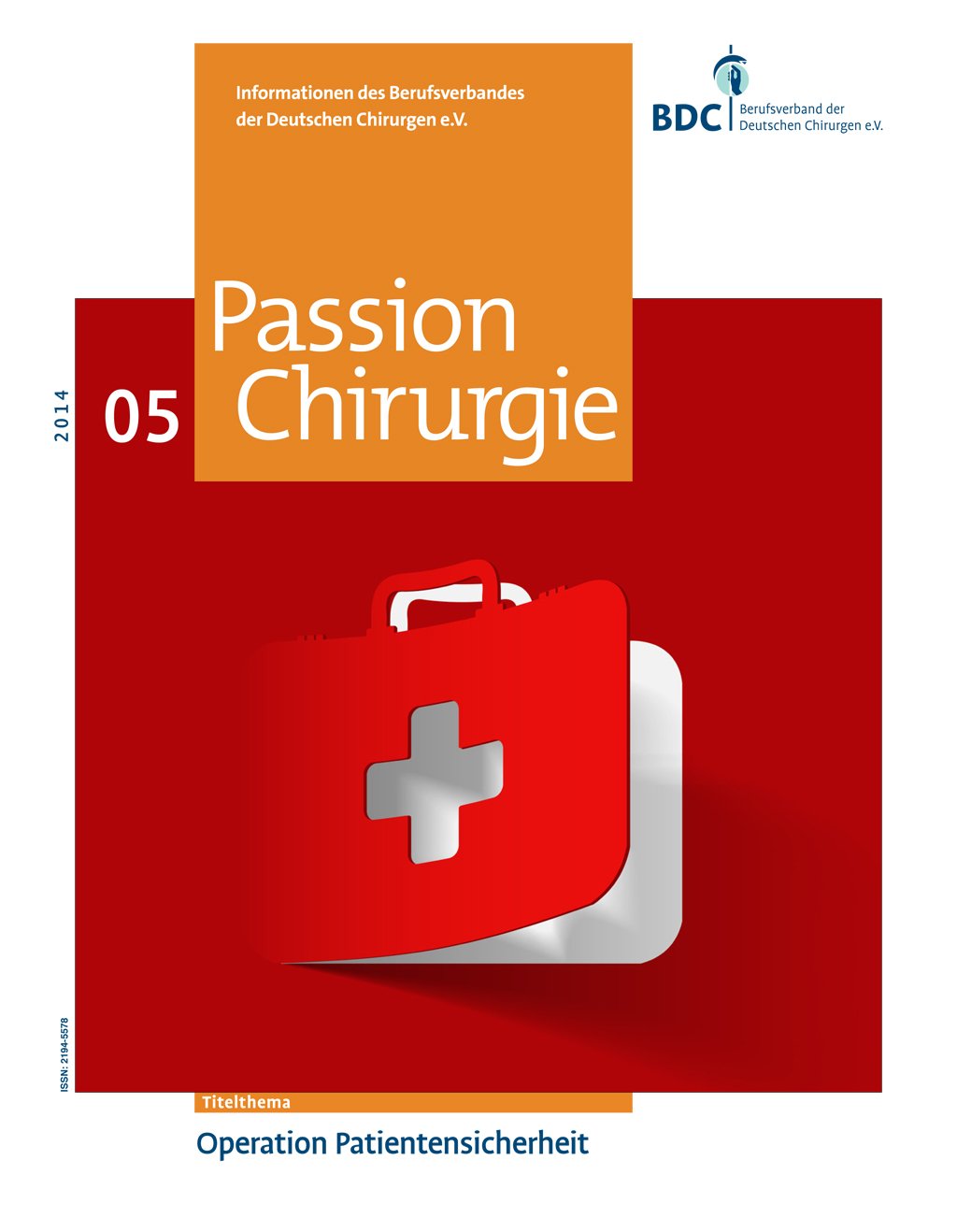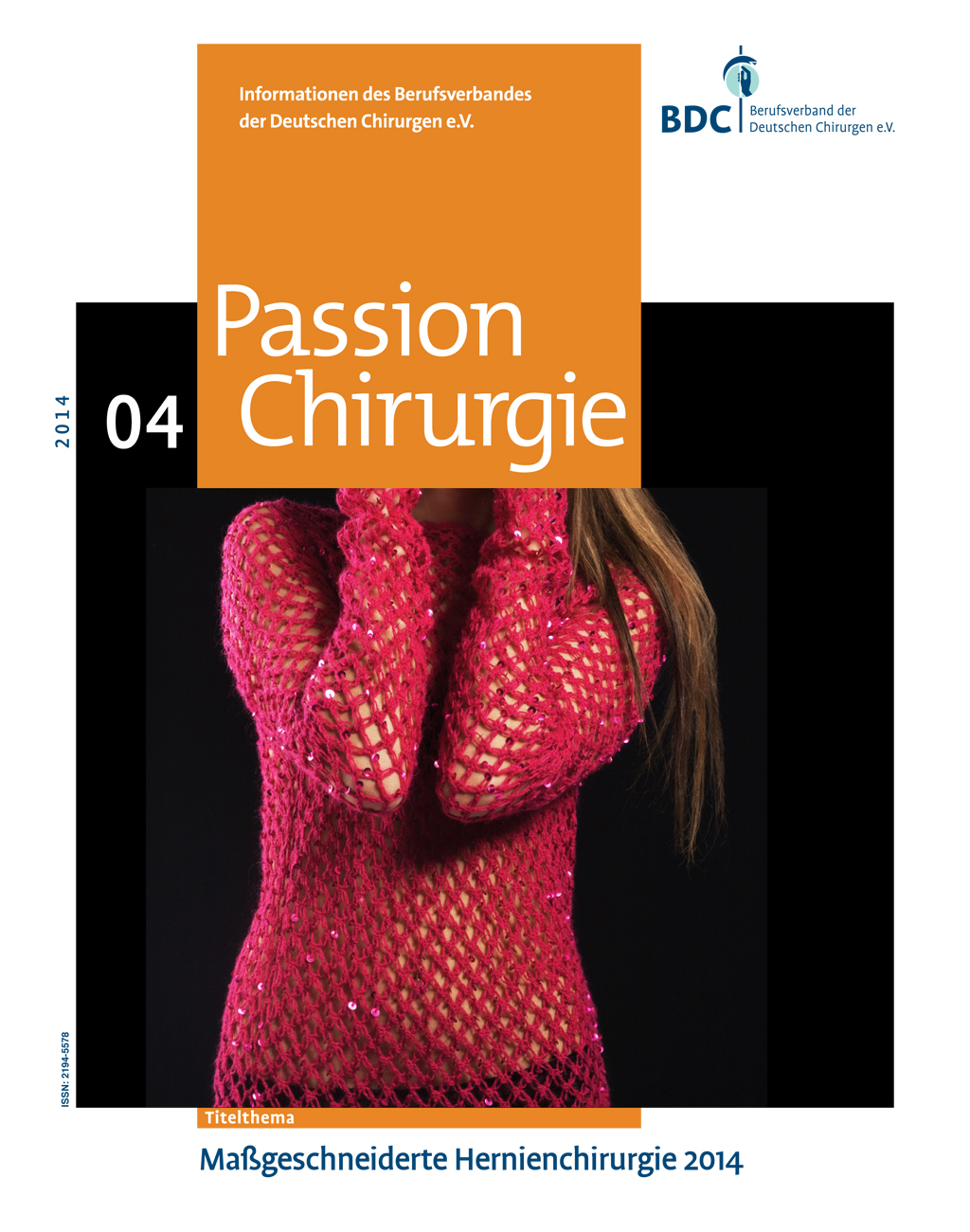12.03.2020 BDC|News
Work-Life-Balance hält Einzug auch in der Chirurgie

Die leitende Oberärztin und Fachärztin für Chirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie, Frau Dr. Frauke Fritze-Büttner, über den Spagat zwischen Job und Beruf, das Mutterschutzgesetz und ihre Motivation, Chirurgin zu werden.
Was war Ihr Impuls bzw. Motivation Chirurgin zu werden?
Fritze-Büttner: Den festen Wunsch Ärztin zu werden, hatte ich bereits in der achten Schulklasse. Einen Patienten durch eine Operation zu heilen oder auch zu retten, war Faszination und mein persönlicher Antrieb zugleich, diesen Beruf zu ergreifen. Im Übrigen gegen den Ratschlag meines Vaters, der selbst Mediziner war. Er dachte an all diese Hindernisse wie überlange Arbeitszeiten und die mitunter schwierige Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Mehr als 60 Prozent der Medizinstudierenden sind weiblich. Als Chirurginnen arbeiten gerade aktuell nur 17 Prozent. Warum ist das Fach Chirurgie offenkundig nicht so attraktiv für Frauen?
Fritze-Büttner: Zu berücksichtigen ist, dass innerhalb der chirurgischen Fachdisziplinen der Anteil an Frauen variiert, so sind viel mehr Chirurginnen viszeralchirurgisch als kardiochirurgisch tätig. Ein Teil der Medizinstudentinnen schreckt sicherlich vor dem Alltag in der Chirurgie zurück – auch weil die Arbeit in einem chirurgischen Fach nicht immer planbar ist. Zum anderen sollten sich die jungen Kolleginnen selbstbewusst den chirurgischen Beruf zutrauen, der neben handwerklicher Geschicklichkeit, eine hohe Einsatzbereitschaft und Courage erfordert.

Sie sind selbst Mutter eines Sohnes. Wie schaffen Sie den Spagat zwischen Job und Familie?
Fritze-Büttner: In meinem Falle kann ich auf ein gut funktionierendes familiäres Back-up zurückgreifen: Das heißt, mein Mann unterstützt mich und auch die Großeltern springen mal ein. Ich habe aber auch das persönliche Ziel, die Klinik zu einer gewissen Uhrzeit zu verlassen, um dann auch intensiv Zeit mit meinem Sohn verbringen zu können. Um dies umsetzen zu können, hilft auch unsere Abteilungskultur, in der die Vereinbarkeit von Beruf und Familie Priorität hat.
Inwieweit spielt es eine Rolle, dass es in der Chirurgie nur wenig weibliche Vorbilder gibt?
Fritze-Büttner: Das stimmt. In der Vergangenheit war die Chirurgie ein männlich dominiertes Fach. Die Chirurginnen profilierten sich erst in den letzten Jahrzehnten. Als ich 1996 an der chirurgischen Klinik in Greifswald anfing, waren wir von zirka 23 Kollegen nur drei Frauen. Das ändert sich nun erfreulicherweise, wenn auch langsam.
Studien zeigen, dass besonders viele Medizinstudierende im Praktischen Jahr (PJ) abspringen. Muss sich die Ärztezunft nicht darüber Gedanken machen, wie das PJ attraktiver gestaltet werden kann?
Fritze-Büttner: Wir müssen die Studenten für unser Fach begeistern. Das geht vor allem, wenn wir auf sie eingehen und sie in unsere Tätigkeit einbeziehen. Dazu gehören Vorlesungen, Bedside-Teaching und Nahtkurse. Wichtig ist aber auch, dass wir ihnen Wertschätzung entgegenbringen und ihnen vorleben, wie ein gutes Team funktioniert und wie man auch in unserer Profession eine work-life-balance umsetzen kann.
Das Mutterschutzgesetz, das eine Hürde für angehende Chirurginnen darstellte, wurde inzwischen reformiert, so dass auch schwangere Chirurginnen ihre Weiterbildung fortsetzen können. War das eine ausreichende Reform oder gibt es noch Handlungsbedarf?
Fritze-Büttner: Leider ja, es ist nach wir vor so, dass schwangere Chirurginnen ihre operative Tätigkeit nicht oder nur sehr erschwert fortführen können. Das Problem sind die “unverantwortbaren Gefährdungen“. Die Ärztinnen könnten unter Umständen zum Beispiel Röntgenstrahlen, Narkosegasen oder auch Infektionskrankheiten ausgesetzt sein, die die Gesundheit von Mutter und Kind gefährden könnten. Und weil die Haftungsfrage ungeklärt ist, entscheiden Arbeitgeber in der Regel sehr restriktiv.
Im Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend ist mittlerweile ein Ausschuss eingerichtet worden, der in Fragen des Mutterschutzes beratend tätig ist. Das hat aber bislang noch keine Auswirkungen auf die Praxis der Chirurginnen. Das heißt, junge angehende Chirurginnen, die schwanger werden, müssen mit Unterbrechungen in ihrer operativen fachärztlichen Weiterbildung rechnen.
Flexible Arbeitszeiten, die den Beruf mit der Familie vereinbaren, sind nicht nur für Chirurginnen, sondern auch für ihre männlichen Kollegen ein großes Thema. Inwieweit sind die Arbeitgeber schon darauf eingestellt und was müsste sich da noch tun?
Fritze-Büttner: Das Thema betrifft im Grunde alle Fachrichtungen. Ich bin überzeugt davon, dass es ein Umdenken bei den Chefärzten und Geschäftsführungen der Kliniken geben wird. Einfach, weil sich die jungen und ÄrztInnen den Arbeitsplatz künftig aussuchen können. Und da spielen die Themen Teilzeit, Überstundenerfassung und -ausgleich, Elternzeit – für Mütter und Väter –, Kinderbetreuung und flexible Arbeitszeiten, angepasst an die Organisationsstrukturen der Abteilung, eine ganz große Rolle. Auch über Jobsharing sollten wir uns zunehmend Gedanken machen. Warum sollen sich nicht zwei KollegenInnen eine Stelle teilen?
Autor:in des Artikels
Weitere aktuelle Artikel
01.02.2025 BDC|News
„Besser heilen – ambulant operieren“ – Bundeskongress Chirurgie 2025
Unter dem Motto „Besser heilen – ambulant operieren“ laden wir Sie herzlich zum Bundeskongress Chirurgie 2025 am 21. und 22. Februar in Nürnberg ein. Dieser Kongress ist der wichtigste Treffpunkt für niedergelassene Chirurginnen und Chirurgen, die täglich qualitativ hochwertige und effiziente Arbeit leisten.
28.01.2025 BDC|News
BDC|Schnittstelle – im Fokus: Professor Andreas Kirschniak
Der Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie ist Leiter des Themenreferats Nachwuchs.
28.01.2025 BDC|News
Die drei großen fachärztlichen Berufsverbände einigen sich auf die wichtigsten Themen im Wahl- und Reformjahr 2025
Der BDC lud im Januar BDI und BDA zum Spitzengespräch.
14.01.2025 Aus- & Weiterbildung
Update zu Hybrid-DRGs bei ambulanten Operationen am 11.02.2025 online
Seit dem 01.01.2024 existieren nach einer Ersatzvornahme des Bundesministeriums für
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.