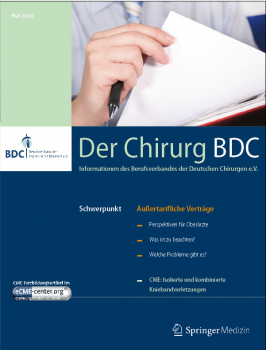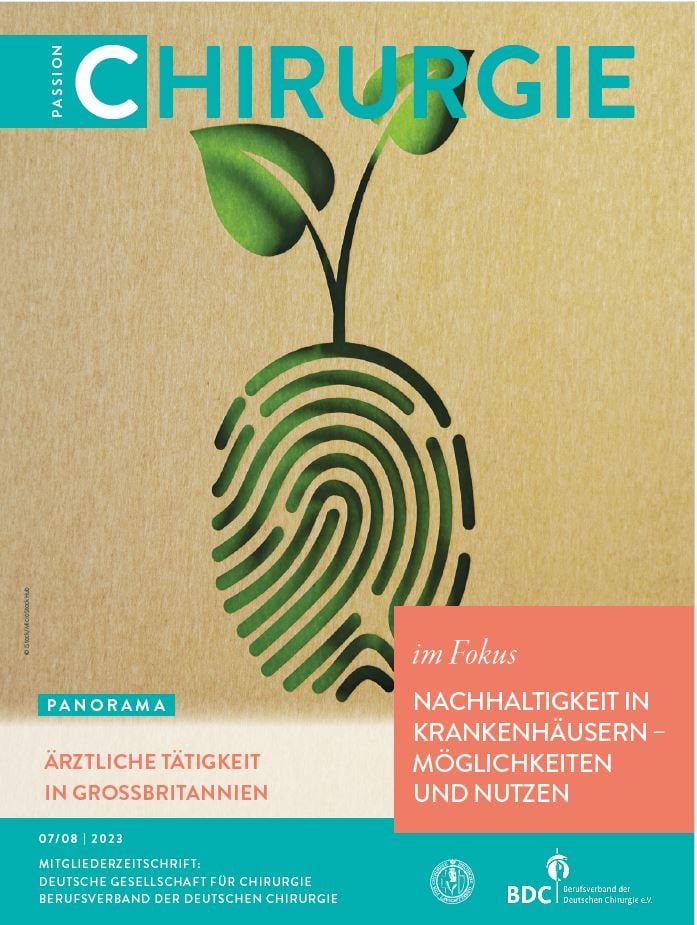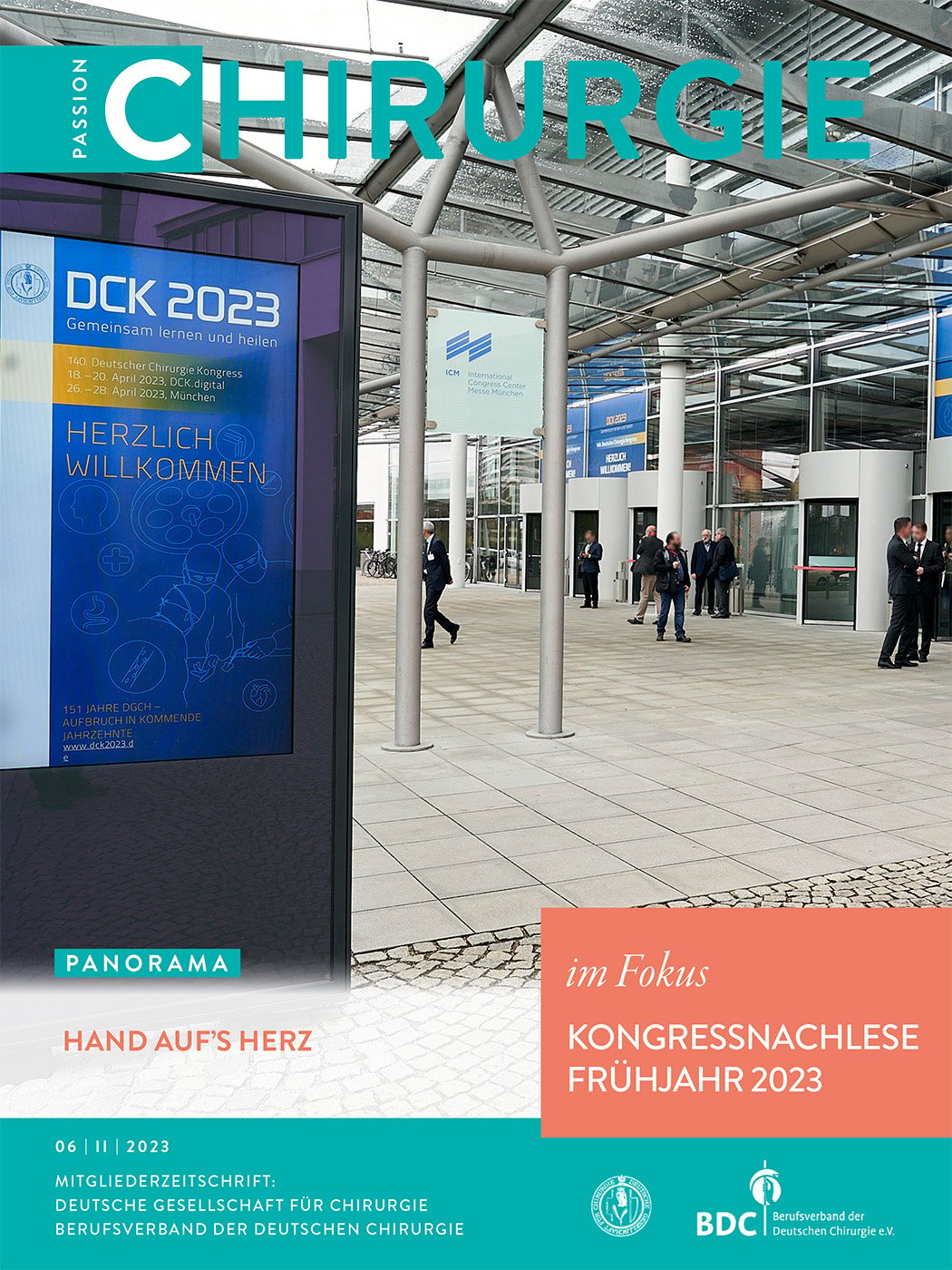01.05.2010 Hygiene-Tipp
Hygiene-Tipp: Raumlufttechnische (RLT)-Anlagen beim ambulanten Operieren – Teil 2
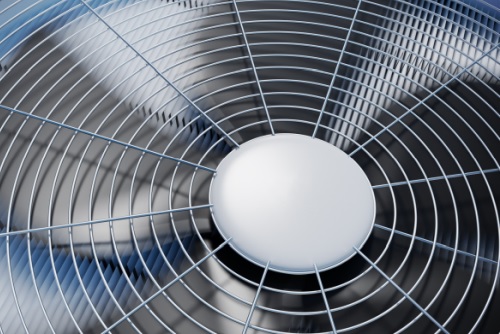
2008 wurde die DIN 1946-4 überarbeitet. Danach gibt es eine Raumklasse I (mit endständiger dritter Filterstufe), die für OP-Säle gilt, und eine Raumklasse II (keine dritte Filterstufe) für alle sonstigen Räume.
Raumklasse !a fordert eine turbulenzarme Verdrängungsströmung (TAV – d.h. Gewebedecken) mit einem Schutzbereich von 3 x 3 m, entsprechend einem TAV-Auslass-System von 3,2 x 3,2 m; bei Raumklasse Ib sind auch Drallauslässe zulässig. Raumklasse Ia ist vor allem gefordert für Implantate (z.B. TEP an Hüfte und Knie, Transplantationen) und mehrstündige Operationen. Auch Instrumententische sollen im Laminar Flow stehen (wenngleich dieses in der Praxis nicht immer zu realisieren ist), dies gilt auch für das zeitversetzte und andernorts erfolgende Richten der Instrumententische.
Die DIN 1946-4 aus dem Jahr 2008 gilt nicht für bestehende OP-Abteilungen. Bei Neuplanungen ist sie allerdings zugrundezulegen. Bauherr und beratender Hygieniker – in Absprache mit dem endabnehmendem Gesundheitsamt – sollten vorher unbedingt die Raumklasse und die Erfordernisse an die RLT-Anlage definieren. Da ein OP im allgemeinen über 20 bis 30 Jahre genutzt wird und die Schwere der Operationen sowie das Infektionsrisiko der Patienten nach aller Wahrscheinlichkeit zunehmen werden, sollte eher eine hochwertige Ausstattung angestrebt werden.
Wegen der multifunktionalen Nutzung von OP-Sälen wird also auch weiterhin die turbulenzarme Verdrängungsströmung Stand der Technik sein. Die neue DIN 1946-4 schreibt darüber hinaus umfangreiche Qualifizierungen der Anlage sowie eine hygienische Abnahmeprüfung vor. Neu sind aufwendige Strömungsvisualisierungen und eine Schutzgrad- oder alternativ Turbulenzgradmessung. Ferner werden mikrobiologische Überprüfungen mittels Sedimentationsplatten empfohlen. Dies alles wird allerdings von vielen Seiten kritisch gesehen. Deshalb hält das Niedersächsische Landesgesundheitsamt die in der DIN 1946-4 aus 2008 vorgeschlagenen Prüfverfahren nicht für erforderlich und für zu zeitaufwendig und kostspielig.
Aus seiner Sicht reichen die bisherigen Prüfverfahren aus (d.h. vor allem Dichtsitz und Leckfreiheit der 3. Filterstufe prüfen, jährlich Partikelmessung nach der 3. Filterstufe durchführen und Strömungsrichtungen bestimmen). Es empfiehlt weiter für Räume der Raumklasse Ia auch eine Strömungsvisualisierung. Ob auch aufwendige Keimzahlmessungen nach der 3. Filterstufe jährlich durchgeführt werden müssen, sollte mit dem beratenden Hygieniker entschieden werden. Allein aus diesem Grund empfiehlt sich dringend die laufende Beratung durch einen Facharzt für Hygiene
Autoren des Artikels
Prof. Dr. med. Walter Popp
Ärztlicher LeiterHyKoMed GmbHVizepräsident der Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (DGKH) kontaktierenProf. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow
Chefarzt des Hygiene-Instituts der REGIOMED-Kliniken Bayern/ Thüringen kontaktierenWeitere Artikel zum Thema
01.09.2023 Hygiene-Tipp
Hygiene-Tipp: Welche Kontrollen einer Sterilgutverpackung (Sterilbarrieresystem) sind vor der Operation notwendig?
Vor der Operation sind verschiedene Kontrollen der Sterilgutverpackung notwendig, um sicherzustellen, dass das Instrument oder das medizinische Gerät, das darin enthalten ist, steril ist und somit keine Infektionsrisiken für den Patienten darstellt.
01.08.2023 Hygiene-Tipp
Hygiene-Tipp: Freigabe aufbereiteter Medizinprodukte
Nach der KRINKO/BfArM-Empfehlung (2012) endet die Aufbereitung von Medizinprodukten mit der dokumentierten Freigabe zur Anwendung.
01.06.2023 Hygiene-Tipp
Hygiene-Tipp: Feuchtarbeit – Chirurgen eher nicht mehr betroffen
Bisher wurde das ausschließliche Tragen von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen für kumuliert mindestens zwei Stunden als Feuchtarbeit angesehen. Die im Oktober 2022 aktualisierte TRGS 401 (Gefährdung durch Hautkontakt – Ermittlung – Beurteilung – Maßnahmen) gibt dies nicht mehr vor.
01.05.2023 Hygiene-Tipp
Hygiene-Tipp: Handys im OP-Saal
Die Nutzung privater Mobiltelefone im OP-Saal hat zu unterbleiben. Sie stören den Ablauf der Operation und mindern vermutlich die Konzentration des OP-Teams. Lange ist bekannt, dass Gespräche während einer Operation trotz Tragen eines chirurgischen Mund-Nasen-Schutzes die Luftkeimzahl an Mikroorganismen aus der Mundflora erhöhen.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.