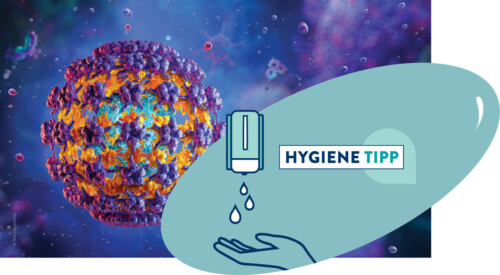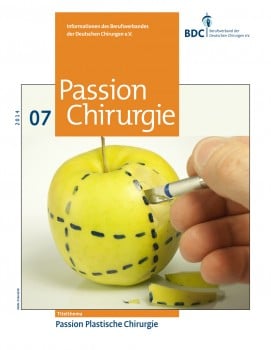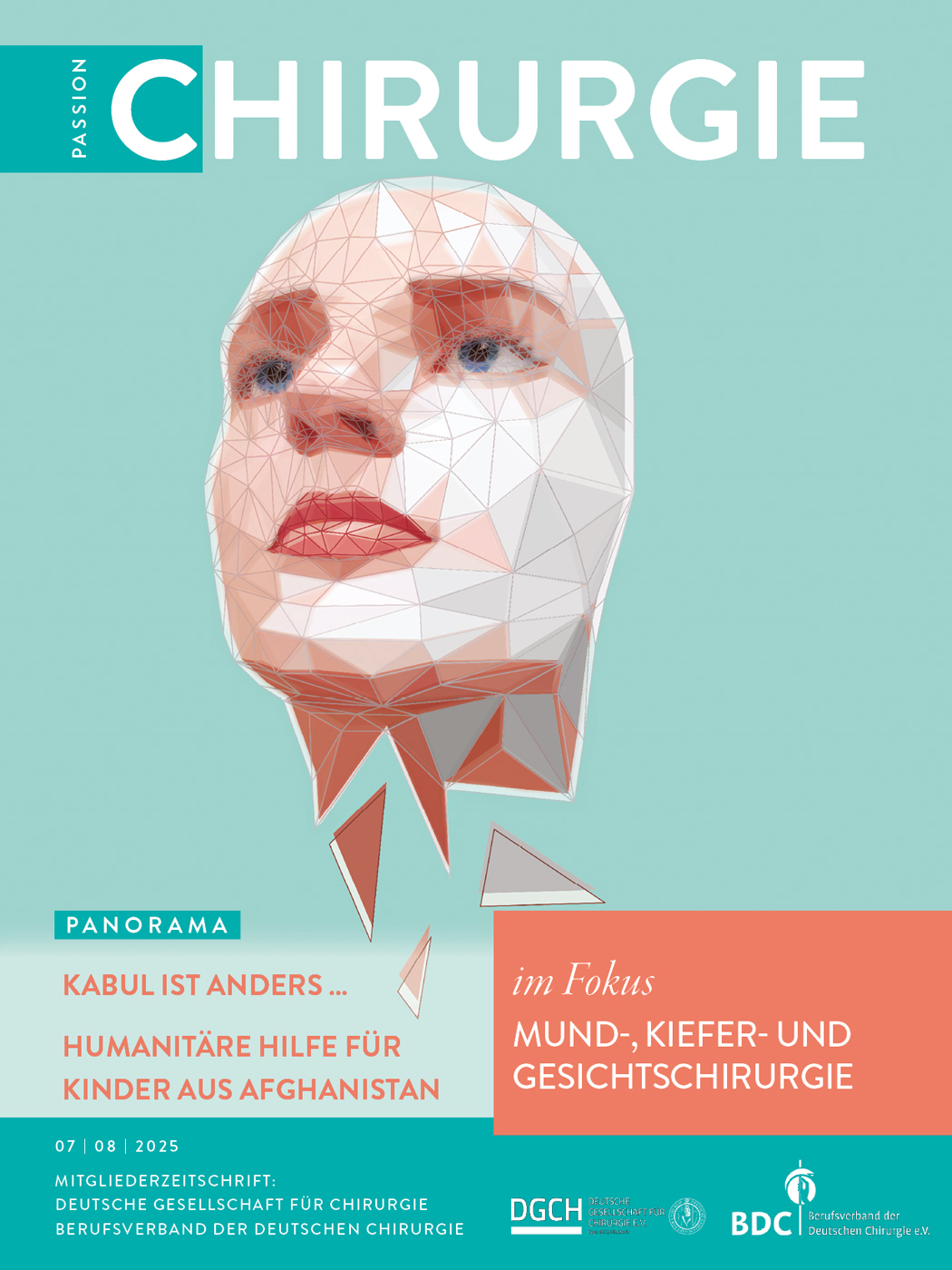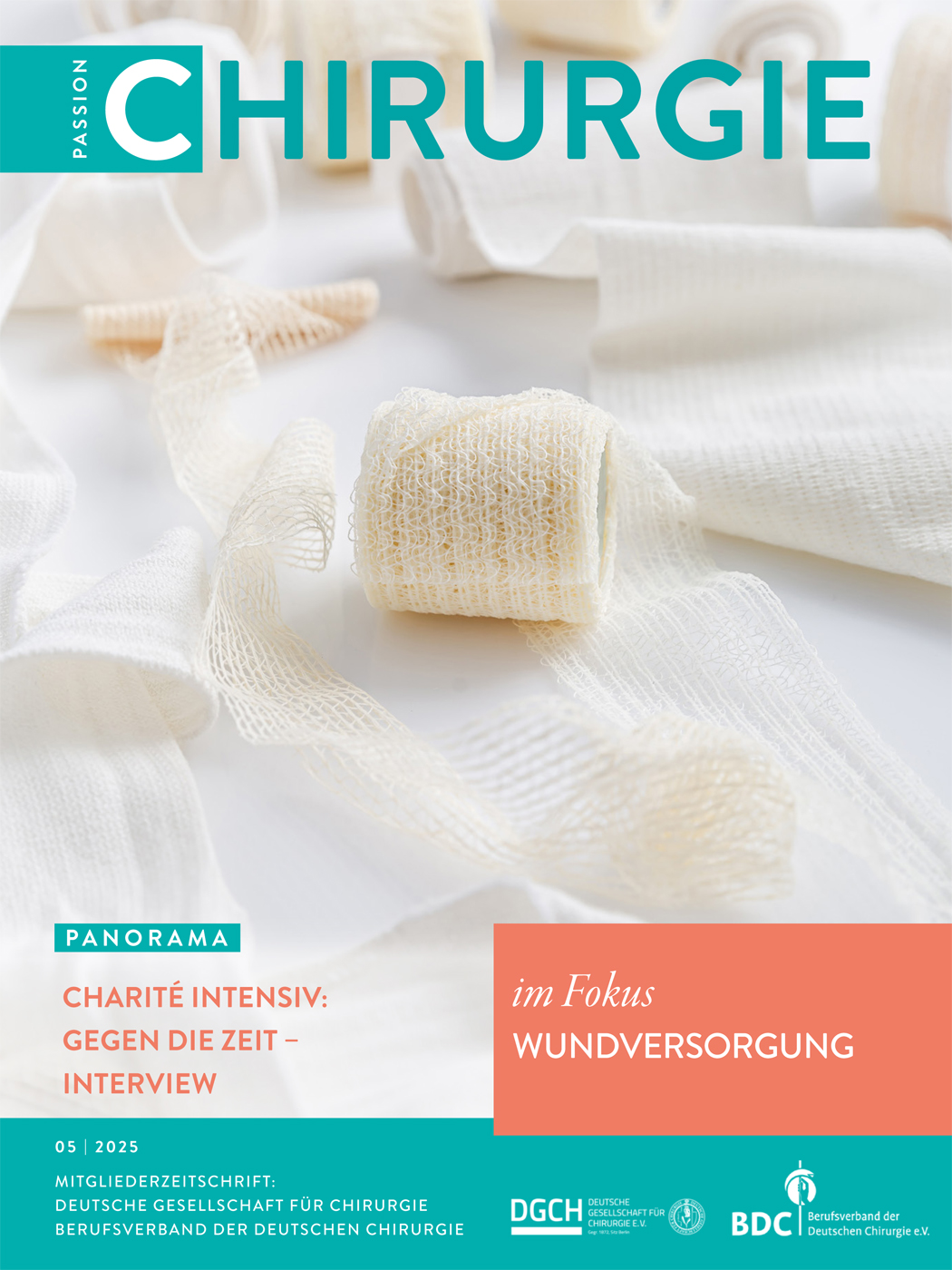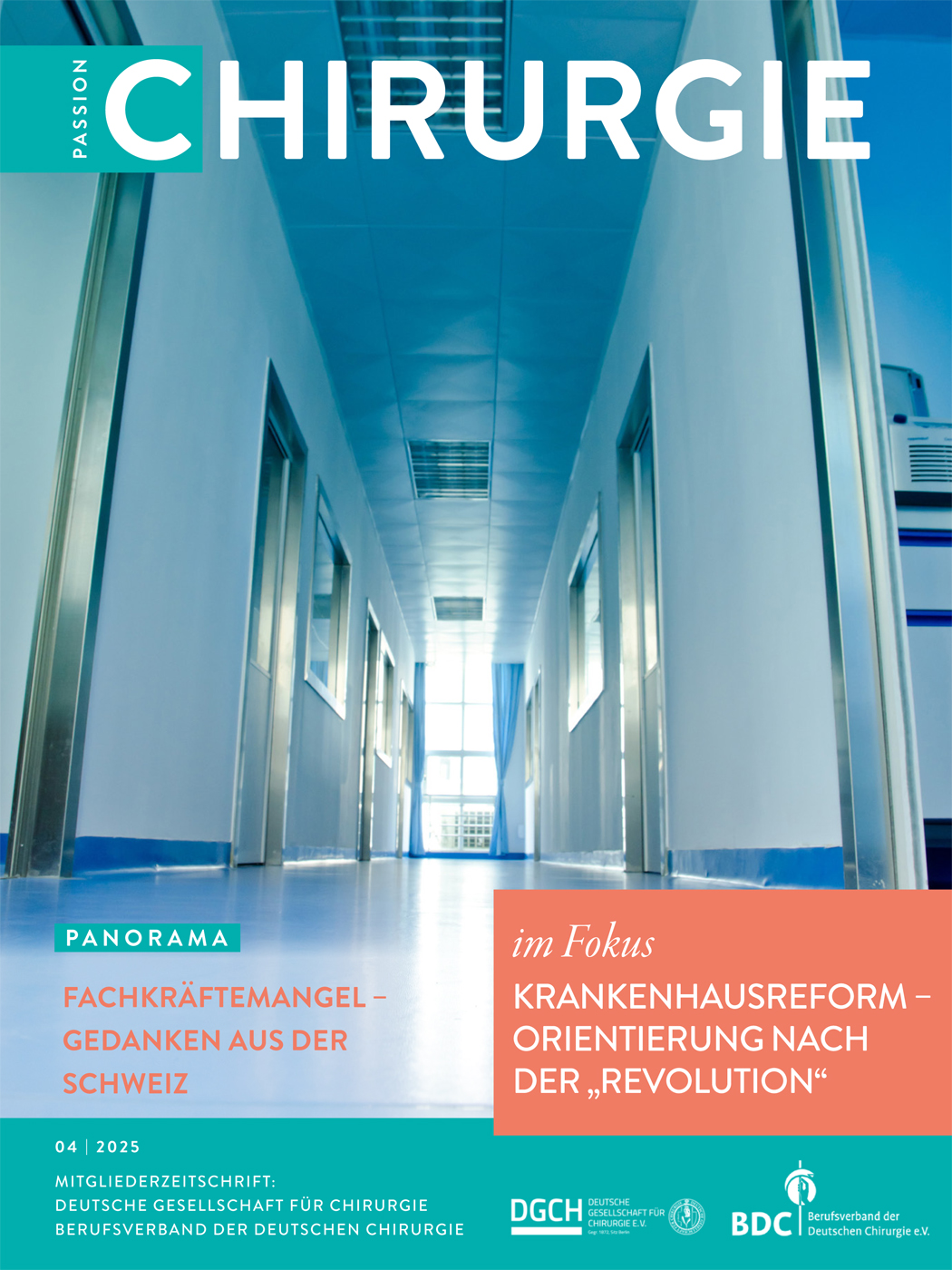01.07.2014 Hygiene-Tipp
Hygiene-Tipp: Häufigkeit von multiresistenten Erregern

Seit einigen Jahren stagniert die Zahl der MRSA-Infektionen in Deutschland. Dies ist wahrscheinlich auf die in vielen Krankenhäusern gut etablierten Hygienemaßnahmen zurückzuführen. Auch sind Sanierungsmaßnahmen bei MRSA-Trägern in gut 60 % erfolgreich. Derzeit sind 1,5 bis 2 % der stationären Patienten MRSA-Träger, im Bereich der niedergelassenen Ärzte sind es maximal 0,5 %.
Im Unterschied dazu steigt die Zahl der multiresistenten gramnegativen Erreger massiv an. Die ESBL-Trägerschaft (Begriffe siehe Kasten) hat in den letzten zehn Jahren weltweit massiv zugenommen und sich teilweise verzehnfacht. Die Tendenz scheint sich fortzusetzen.
In Deutschland liegt die Trägerrate der Allgemeinbevölkerung für ESBL im Bereich von 3 bis 4 %, das ist fast zehnmal so hoch wie die MRSA-Trägerschaft.
Nach Daten aus mehreren Ländern liegt die Transmissionsrate im Krankenhaus im Bereich von 4 bis 5 %. Bei hohem Hygienestandard (z. B. in Schweizer Krankenhäusern) kann sie noch deutlich niedriger liegen (bei unter 2 %). Dagegen liegt die Übertragungsrate im Haushalt, wenn dort ESBL-Träger leben, bei rund 25 %. Es besteht also durchaus ein Risiko, im Zusammenleben selbst Träger zu werden – und damit natürlich auch im Umgang mit den Patienten.
Ende 2012 hat die Krankenhaushygiene-Kommission am RKI (KRINKO) Empfehlungen veröffentlicht, wie mit multiresistenten gramnegativen Stäbchen umzugehen ist. Wurde die Multiresistenz in der Vergangenheit eher an der ESBL-Bildungsfähigkeit festgemacht, so entschloss sich die KRINKO zu einer völlig neuen Definition (siehe Kasten): 3- und 4-MRGN bedeuten jetzt gramnegative Erreger, die gegen drei bzw. vier wichtige Antibiotikaklassen resistent sind.
Die Daten zur Dauer der Trägerschaft bei ESBL/MRGN sind derzeit heterogen. Grob geschätzt ist heute davon auszugehen, dass 10 bis 50 % der Träger dies dauerhaft bleiben. Der Rest scheint aber nach einigen Monaten frei von Keimen zu sein. Insofern rentieren sich durchaus Schutzmaßnahmen und Wiederholungsuntersuchungen. Leider liegen derzeit keine gesicherten Sanierungskonzepte vor, die natürlich auch nicht einfach zu definieren sind, da die meisten Keime im Darm leben.
VRE
Vancomycin-resistente Enterokokken: Darmbakterien (Enterococcus faecium, aber auch Enterococcus faecalis), die gegenüber dem Reserveantibiotikum Vancomycin resistent sind.
ESBL
Bakterien, die Extended Spectrum-ß-Lactamasen (ESBL) bilden. Diese Enzyme spalten Antibiotika und machen sie unschädlich. Vor allem Escherichia coli und Klebsiellen (beide im Darm vorkommend) tragen ESBL-Gene.
MRGN
Multiresistente Gram-negative Bakterien. Es handelt sich um Darmbakterien (z. B. Escherichia coli) und einige Umweltkeime wie Pseudomonas und Acinetobacter, die gegen wichtige in der Intensivmedizin verwendete Antibiotika-Klassen resistent sind. Die Einteilung in 3-MRGN (resistent gegen drei Antibiotikaklassen) und 4-MRGN (zusätzlich resistent gegen eine weitere Klasse) ist eine deutsche Regelung der KRINKO.
ESBL-Bildner und MRGN überlappen sich, sind aber nicht identisch.
Der Hygienetipp gibt die Meinung der Autoren wieder.
Popp W. / Zastrow K.D. Hygiene-Tipp: Häufigkeit von multiresistenten Erregern. Passion Chirurgie. 2014 Juli; 4(07): Artikel 03_03.
Autoren des Artikels
Prof. Dr. med. Walter Popp
Ärztlicher LeiterHyKoMed GmbHVizepräsident der Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (DGKH) kontaktierenProf. Dr. med. Klaus-Dieter Zastrow
Chefarzt des Hygiene-Instituts der REGIOMED-Kliniken Bayern/ Thüringen kontaktierenWeitere aktuelle Artikel
29.07.2025 Hygiene-Tipp
Hygiene-Tipp: Tischabdeckung im OP
Ich habe eine Frage aufgrund einer Inspektion der Überwachungsbehörde zum „Vollzug des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes“. Es betrifft die Aufbereitung von unseren grünen OP-Tüchern, die wir für die Abdeckung der Instrumententische verwenden. Dürfen wir OP-Tücher aus Baumwollmischgewebe zur Abdeckung des Instrumententisches weiterhin sterilisieren und im OP verwenden?
27.07.2025 Hygiene-Tipp
F&A: Begründet die Elektronische Patientenakte (ePA) eine weitere Haftungsquelle?
Ein niedergelassener Chirurg fragt an, ob die künftige elektronischen Patientenakte (ePA) eine weitere Haftungsquelle im Rahmen der Arzthaftung begründet.
01.06.2025 Hygiene-Tipp
Hygiene-Tipp: Untersuchung des Trinkwassers auf Pseudomonas
Fallen ambulant operierende Praxen gemäß Pkt. 4.2.b der UBA-Veröffentlichung von 2017 unter untersuchungspflichtige Einrichtungen und müssen dementsprechend regelmäßige Untersuchungen des Trinkwassers auf Pseudomonas aeruginosa (gemäß DVGW W 551-4 (03/2024)) durchführen?
01.05.2025 Hygiene-Tipp
Hygiene-Tipp: Viruzide Händedesinfektion bei Versorgung von HPV-Patienten
Wir haben immer wieder Anfragen zum Umgang mit Patienten mit Humanen Papillomviren im Operationsbereich. Gemäß VAH-Liste benötigen wir den Wirkbereich „viruzid“ für die Flächendesinfektion. Benötigen wir dies auch für die hygienische Händedesinfektion bei Kontakt mit möglicherweise kontaminierten Oberflächen? Oder ist begrenzt viruzid PLUS ausreichend?
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.