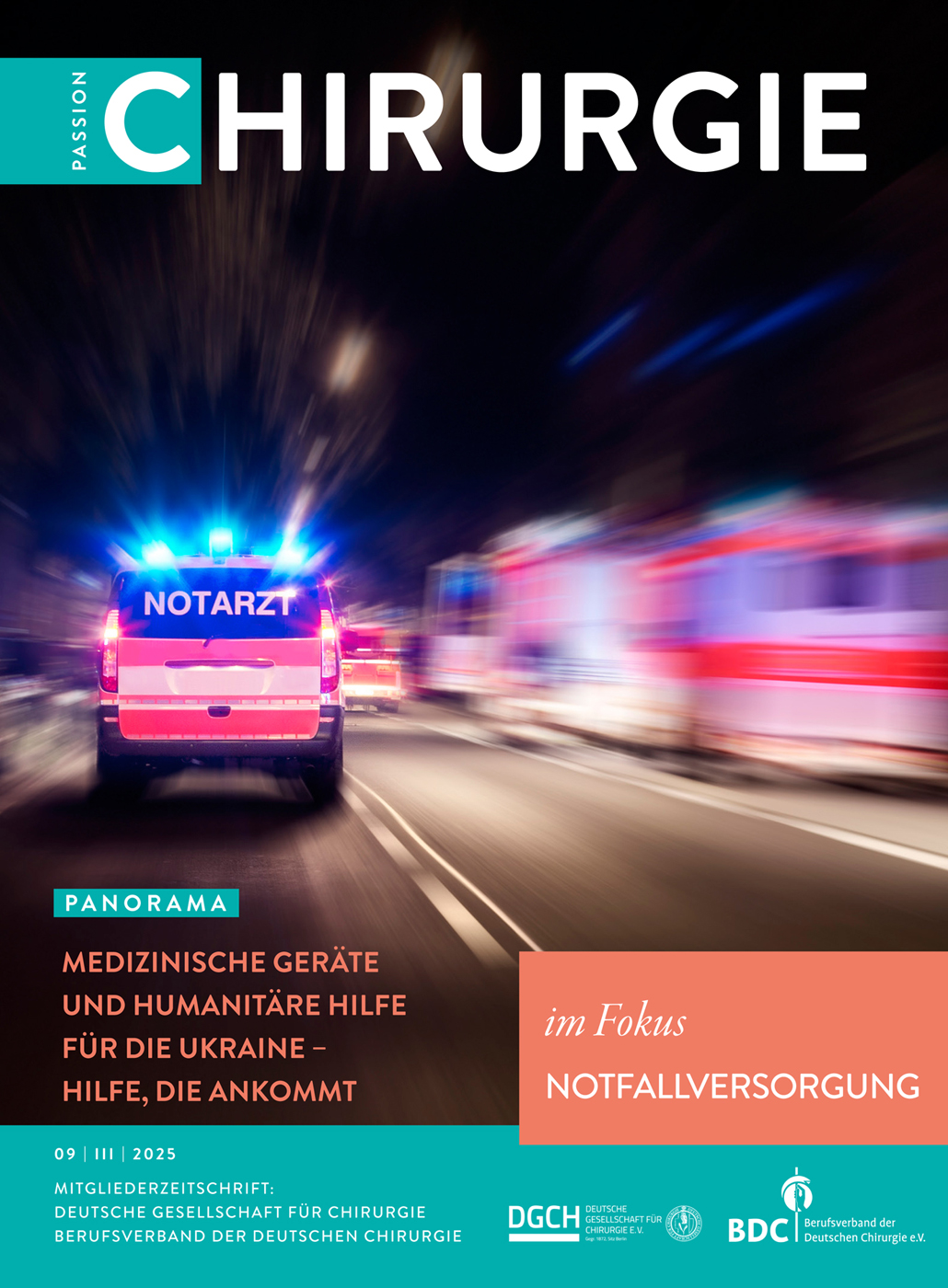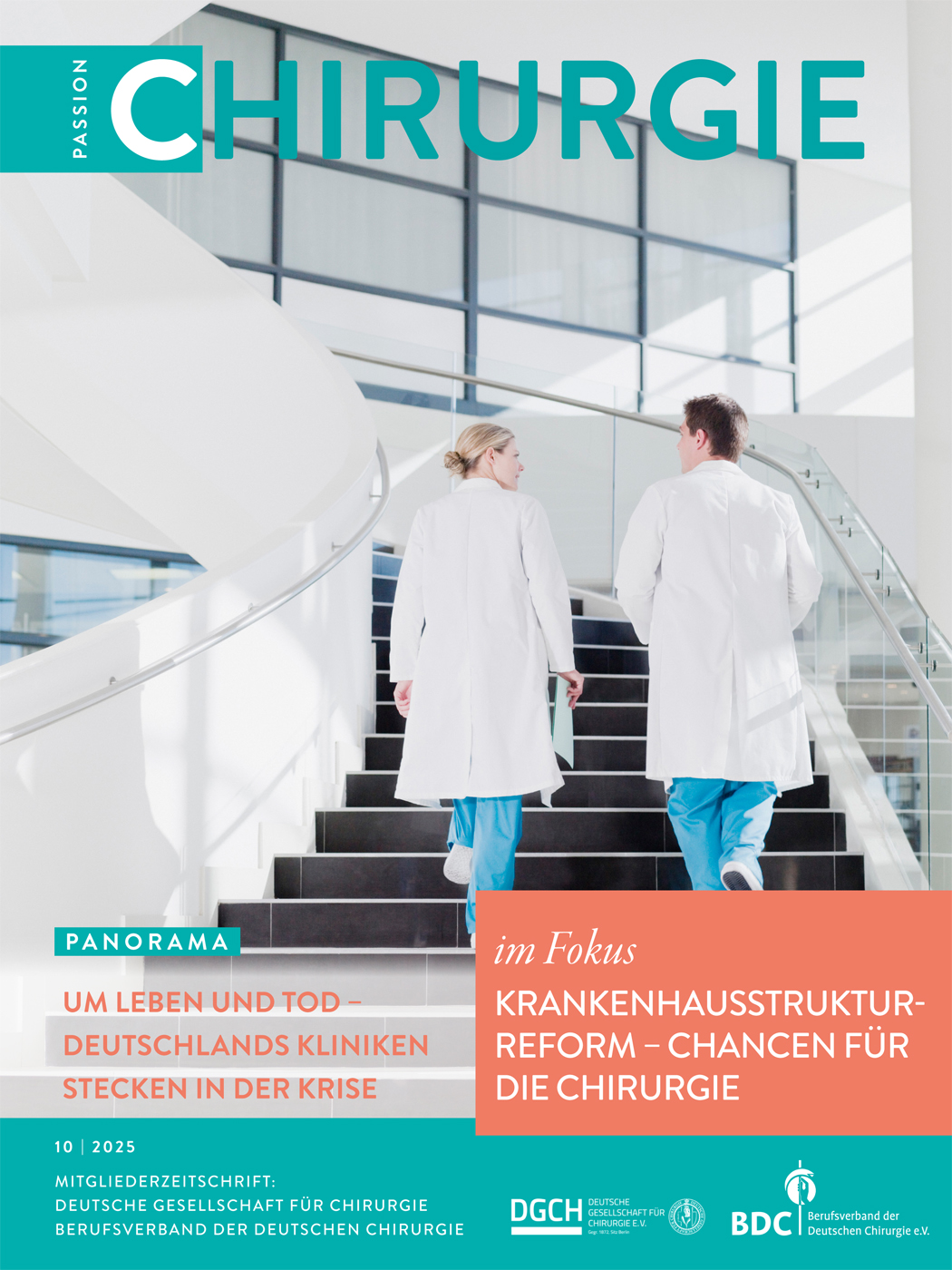01.09.2025 Orthopädie/Unfallchirurgie
Generationenwechsel und Strukturwandel im Unfallkrankenhaus Berlin

Beruf: Chefarzt, Ärztlicher Direktor, Forscher und Dozent – Prof Dr. Georg Osterhoff
PASSION CHIRURGIE: Herr Professor Osterhoff, Sie starteten im Juli 2025 als neuer Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie und in Personalunion auch als Ärztlicher Direktor des ukb mit 430 Ärzten. Neu ist die Anbindung der BG-Kliniken an Universitäten. In Berlin also des ukb an die Charité, an der Sie somit gleichzeitig einen Ruf für eine W3-Professur erhalten haben.
Was heißt das für Sie konkret im Hinblick auf Patientenversorgung, Manager für viele Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftler und Dozent … Wie wollen sie das eigentlich alles unter einen Hut kriegen?
Georg Osterhoff (GO): Man kann all die Dinge kombinieren. Ich glaube, dass es das ist, was mich motiviert hat, Chefarzt zu sein oder sogar jetzt eine erste Direktion zu übernehmen. Damit kann ich nicht nur einzelne Patientenschicksale beeinflussen, sondern auch strukturell organisatorisch Abläufe im Krankenhaus so optimieren, dass viele davon profitieren. Es ist doch so: Wir haben mehr Leute durchs Händewaschen und durch die Erfindung des präoperativen Händewaschens gerettet als durch hervorragende Operateure.
Aber natürlich freue ich mich auch darauf, dass ich weiterhin an Patienten arbeiten kann. Mir macht Operieren Spaß. Es sind die kleinen Momente, wenn man nach der Operation noch mal zu den Patienten hingeht, mit ihnen spricht und auch direkt Dankbarkeit empfängt. Das sind Erlebnisse, die mir Energie geben. Gerade die Kombination aus beidem ist toll.
Forschung und Wissenschaft war immer mein dritter Pfeiler, aus dem ich Energie gezogen habe, der mir Freude bereitet hat. Wenn man hervorragende exzellente Medizin machen will, muss man immer auch am Puls der Forschung bleiben, und das geht am besten, wenn man selber Forschung macht oder sich damit intensiv beschäftigt. Das Großartige ist, dass wir das in Kooperation mit der Charité betreiben können, d. h. die Charité ist unser fester Partner.
Mein Wunsch und mein Ziel wäre es, hier im ukb eine gewisse Akademisierung zu schaffen. Also, dass jede Ärztin, jeder Arzt, aber auch die Pflege und die medizinisch-technischen Berufe verstehen, was der Sinn von Forschung ist, wie uns das vorwärtsbringen kann und wie das vor allem unseren Patientinnen und Patienten zugutekommt.
Gab es einen Moment in ihrer Aus- oder in der Weiterbildung, in dem Ihnen die Erkenntnis kam, ich muss nach vorne, an die Spitze, ich will Chefarzt werden oder war das eher etwas, was sich über die Zeit so ergeben hat? Gab es einen Förderer oder Mentor?
GO: Also, von allem ein bisschen: Als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich nicht die Vorstellung, Chefarzt zu werden. Da wollte ich in die Niederlassung gehen und habe gedacht, das wird mein Leben. An der Niederlassung ist attraktiv, dass man selber organisieren kann.
Ich hatte aber auch eine entscheidende Person: Das war mein Doktorvater. Bei dem habe ich was gespürt, eine Begeisterung für Forschung, und die hat er auf uns, seine Doktoranden, übertragen, sodass wir mit ihm bis 4:00 Uhr nachts Schafe operiert haben. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass für eine Sache hart zu arbeiten richtig Spaß machen kann, und dass dann auch was rauskommt, aber auch, dass es Niederlagen gibt.
Als ich die ersten Daten von meiner Doktorarbeit angeguckt habe, hatte ich Tränen in den Augen, weil das so wenig war, ja, und dann noch mal ranzugehen und doch noch was draus zu machen und das zu entwickeln, das war was, was ich dann sehr inspirierend fand.
Und dann gab es natürlich auch Momente, und das geht ja allen Assistenten irgendwann mal so, wo man nicht in den OP kommt und stattdessen nur Dokumentationstätigkeit erledigt und denkt, dafür bin ich doch nicht Arzt geworden.
Da war Forschung gleichzeitig auch immer eine Möglichkeit, parallel etwas für mich selbst zu schaffen, wo ich wusste, egal, das wird immer mein Paper sein. Und in diesem Rahmen wurde mir dann zunehmend von außen Rückmeldung gegeben, dass ich das offensichtlich gut mache. Man hat mir dann Verantwortung angetragen. Das hat mir Spaß gemacht, und dann habe ich mich zusehends mit dieser Idee angefreundet, und dann irgendwann ja auch in die Richtung gearbeitet.
Aber die Gelegenheiten sind eigentlich mehr auf mich zugekommen, als dass ich von Anfang an hartnäckig einen Plan verfolgt hätte. Natürlich, irgendwann ist der Entschluss da. Ich musste mich entscheiden, wo entwickle ich mich chirurgisch hin. Und da habe ich dann die Entscheidung für Wirbelsäulen- und Beckenchirurgie getroffen. Damit ist die Niederlassung nicht mehr infrage gekommen.
Ich habe mal in einem Interview mit der Gräfin Marion Dönhoff gelesen, die gefragt wurde: „Wie haben sie es geschafft als eine Frau, die mit dem Handwagen nach dem Krieg aus Ostpreußen über die Grenze geflohen ist, Herausgeberin der Zeit zu werden?” Und die hat gesagt, sie sei nicht mit der Idee aufgewacht, Herausgeberin der Zeit werden, sondern sie hat gesagt, und diesen einen Spruch habe ich immer versucht zu befolgen: „Man muss dem Zufall eine Chance geben.“ Also das heißt, dass man immer versucht, Optionen zu wählen oder Entscheidungen zu treffen, die einem noch Möglichkeiten offenlassen.
Sie hatten also starke Vorbilder in der Forschung. Gab es denn auch so etwas wie „Antibilder“, also Vorgesetzte, wo sie gesagt haben, so will ich nicht werden?
GO: Ich muss vielleicht vorausschicken, ich hatte viele Vorbilder. Ich habe ja in fünf Kliniken und in drei Gesundheitssystemen gearbeitet. Und habe da ganz viele Persönlichkeiten getroffen, von denen ich unglaublich viel gelernt habe. Sowohl Positives als auch Negatives. Ich hatte einen Vorgesetzten, der hat hervorragend operiert, aber wenn er eine Komplikation hatte, ist er nicht mehr zu dem Patienten gegangen. Also man kann durchaus auch in seinen Vorbildern Dinge entdecken, wo man sagt, das möchte man vielleicht später anders machen und ich glaube, das ist mir eigentlich überall so gegangen.
Ich habe fünf Chefärzte bei ihrem Anfang beobachten dürfen, und da habe ich mir relativ klar rausgezogen, was ich auch so mache und was nicht. Es gab einen Chef, den musste man zur Entscheidung zwingen, und ich hatte einen Chef, der hat immer entschieden, ohne vorher auch mal die Meinung anderer anzuhören. Und irgendwo dazwischen muss es sein.
Was ich immer bewundert habe, sind Leute, die Haltung haben, die nicht nur Dinge sagen, sondern die sie auch so leben und Vorbild sind. Die ihre Prinzipien klar erkennbar selbst befolgen. Und als Gegenstück Leute, die das nicht tun, die wären das Antibild.
Hatten Sie in Ihrer Karriere mal Rückschläge oder hatten Sie mal eine richtig große Hürde zu überwinden? Wie haben Sie darauf reagiert oder wie gehen Sie damit um?
GO: Also, das kommt ja andauernd vor. Das ist aber das, woran man wächst, und deswegen habe ich auch immer versucht, meine Mitarbeiter in Situationen zu bringen, wo sie Hürden begegnen. Ich glaube, man muss auch Aufgaben zuteilen, die nicht problemlos zu 100 Prozent bewältigt werden können, weil genau das dann passiert.
Wir möchten nochmal zu Ihren Leistungsschwerpunkten kommen. Das Wort Polytraumaversorgung steht beim ukb natürlich ganz oben. Wie passt das zu Ihren Schwerpunkten der Becken- und Wirbelsäulenchirurgie?
GO: Verletzungen der Wirbelsäule und des Beckens haben Sie ganz häufig bei Polytraumapatienten. Insofern ist das etwas, was Sie chirurgisch leisten können müssen. Aber eigentlich würde ich bei der Polytraumaversorgung voranstellen, dass nicht nur die operativ chirurgische Expertise, sondern das Patientenmanagement im Schockraum entscheidend für das Outcome ist. Das ist Teamführung, Entscheidungen in kurzer Zeit treffen, das ist aber auch, standardisierte Prozeduren und Prozesse vorher zu klären, eine Infrastruktur aufzustellen, schon bevor der Patient kommt, und dann organisieren, dass alles richtig läuft.
Die Polytraumabehandlung ist das perfekte Beispiel für eine umfassende Unfallchirurgie, und da sehe ich ganz unbedingt meinen Schwerpunkt.
Daneben habe ich sicher in der minimalinvasiven Versorgung von Frakturen in der Beckenchirurgie einen Schwerpunkt, was ich in Kanada gelernt habe. Das werde ich auch hier anwenden und ausbauen.
Und natürlich gehört das klassische Spektrum, das, was ich in Leipzig viel gemacht habe, dazu: Gelenkfrakturen, eigentlich das ganze SAV Spektrum (Anm.: gemeint ist das Schwerverletztenartenverzeichnis der DGUV).
Sie sind ja eines der Gründungsmitglieder der AG Digitalisierung der DGOU. Aktuell befinden wir uns in einem Umbruch, der nicht immer zu positiven Erlebnissen führt. Ein Beispiel: Wir erhalten immer noch umfangreiche Patientenunterlagen zugefaxt, die dann hier im System zu einem pdf-Dokument zusammengefasst abgespeichert werden. Es erfolgt also keine thematische Zuordnung der einzelnen Unterlagen. Digitalisierung, die uns unterstützt, scheint noch nicht so gut zu funktionieren. Wo wollen Sie da Schwerpunkte setzen?
GO: Digitalisierung ist so ein Modeschlagwort geworden. Da wird alles druntergepackt. Am Schluss denke ich, dass es wichtig ist, sich vorher zu überlegen: Was ist das Ziel? Wie messe ich, ob ich das erreicht habe? Zuletzt muss ich mir dann halt angucken: Funktioniert es oder nicht? Also, ich würde mir wünschen, dass keine Briefe mehr zur Unterschrift irgendwohin verschoben werden müssen.
Ich möchte komplette elektronische Verordnungen. Jetzt wäre der nächste Schritt, wenn wir das alles im System haben, warum muss dann ein Arzt noch diktieren oder selber schreiben? Warum kann das nicht die KI vorschreiben, denn da gibt es erste Programme, die das machen. Das wäre sicher ein Projekt, das ich hier gerne beginnen würde.
Warum muss in der Visite immer noch jemand den Befund eintippen? Warum kann das nicht die KI machen, entweder weil ich es kurz reindiktiere, oder wir können noch weiterdenken, weil die einfach mithört im Arzt-Patientengespräch. Auch das gibt es für die Ambulanz schon. Dann sind wir plötzlich nicht mehr 2-3 Stunden im Schnitt mit Dokumentation beschäftigt, sondern haben einfach mehr Zeit für andere Sachen.
Wo kann Digitalisierung noch funktionieren: im Schockraum bei der Versorgung von Polytraumapatienten zum Beispiel. Wir haben in Leipzig gerade ein Tablet für den Trauma Leader im Schockraum. Ein Algorithmus führt leitliniengerecht durch die nächsten Behandlungsschritte. Also Decision Support oder computergestützte Entscheidungsunterstützung ist das. Es gibt Algorithmen, die können alleine an der Art, wie die Sauerstoffkurve pendelt, vorhersagen, ob der Patient eine Bluttransfusion braucht oder nicht.
Wir werden einen großen Bildschirm haben in unserem Schockraum, der uns Hinweise und Empfehlungen gibt. Wir haben das mal simuliert. In der simulierten Schockraumversorgung haben wir gesehen, es werden keine Fehler mehr gemacht, außer von erfahrenen Fachärzten, die sich gegen die Empfehlungen entschieden haben.
Sie übernehmen ein Team junger und älterer Mitarbeiter, die jahrzehntelang unter einem Chef gearbeitet haben. Wie wollen Sie diese Begeisterung, die Sie in sich tragen, rüberbringen? Wie wollen Sie da auch Ängste, die mit dem Beginn eines neuen Chefs verbunden sind, einfangen?
GO: Ich gehe von der Grundannahme aus, dass wir alle wollen, dass unsere Patienten auf hohem Niveau behandelt werden. Und die zweite Annahme: Wir wollen alle Spaß bei der Arbeit haben. Das muss beides funktionieren.
Und dann ist es wie bei jeder Veränderung, man muss offen und klar sprechen. Also genau sagen, was ist das Ziel und wie gedenken wir das zu erreichen? Dann muss es auch Partizipation geben, also die Leute dürfen sich dazu äußern. Kleine Schritte machen und nach jedem Schritt wird geschaut, geht es in die richtige Richtung oder nicht. Was auch klar sein muss, dass Veränderungen kein rein demokratischer Abstimmungsprozess sind, sondern ein gesteuerter Prozess. Das kann man aber in kleinen Schritten erreichen.
Nun sind Sie ja auch neu in der Welt der DGUV und der berufsgenossenschaftlichen Kliniken. Wie wollen Sie sich da positionieren?
GO: Also sicher hatte ich auch in meiner bisherigen Laufbahn Berührungspunkte mit der BG-Welt. Natürlich wird das für mich ein ganz wichtiger Anteil meiner Arbeit sein. Ich habe bereits einige Geschäftsführer und Vorstände aus dem Bereich der DGUV bei verschiedene Veranstaltungen getroffen. Zum Beispiel war ich auf dem Symposium Hochleistungssport und habe auch andere Gremien und Veranstaltungen besucht. Ich fand es sehr beeindruckend, die ehrliche Begeisterung der Teilnehmer und Veranstalter für das BG-Wesen und für die gesetzliche Unfallversicherung.
Das ukb soll da ein Flaggschiff bleiben. Und ein offenes Haus für die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen.
Gibt es berufspolitische Themen, die Ihnen am Herzen liegen? Zum Beispiel Weiterbildung oder andere?
GO: Was mich immer noch verzweifeln lässt, ist, wieso es z. B. in Vancouver möglich war, dass es einen festen Weiterbildungsplan für jeden gab. Und wieso geht das bei uns nicht? Wir haben es in der Schweiz versucht und in Leipzig. Natürlich gibt es immer ein Papier dazu. Aber wieso sich das trotzdem so schwer umsetzen lässt, ist mir ein Rätsel. Vielleicht liegt es an der Struktur unserer Arbeitszeitgesetzgebung. Aber eigentlich muss es ja möglich sein, das zu realisieren. Das ist immer noch was, was ich sehr spannend finde. Die viel größere Frage ist, wen können wir überhaupt noch überzeugen, in unser Weiterbildungscurriculum einzutreten? Wie kann ich Leute überhaupt noch dazu bringen, in der Chirurgie zu arbeiten? Ich glaube, da müssen wir halt umdenken. In Leipzig haben wir 60 VK in der klassischen Chirurgie, aber 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also etwa 40 % Teilzeitarbeiter.
Wenn wir annehmen, die Freude und Begeisterung für die Arbeit generiert sich aus der Arbeit, dann müssten doch diejenigen, die Halbzeit arbeiten, auch nur halb so viel Begeisterung mitbringen. Das ist provokativ gesagt und die jungen Leute werden das anders sehen und anders vertreten und verteidigen.
GO: Also, wir hatten in Leipzig eine Oberärztin, die 80 % arbeitet. Und die ist das Rückgrat eines guten Teams, die macht die Zertifizierung, die macht alles, die organisiert den Laden am Schluss. Und das geht absolut und die ist begeistert dafür. Und zwar auch, weil wir ihr ermöglichen, in dem Beruf, den sie gerne macht, zu arbeiten, ohne andere Verpflichtungen zu vernachlässigen. Und wenn die zeitliche Arbeitsbelastung der Grund dafür ist, den Beruf nicht mehr zu mögen, dann wäre das fatal.
Das ist eine gute Überleitung zu mehr persönlichen Fragen. Wie sind Sie denn hier angekommen in Berlin? Wie hat Ihre Familie das aufgenommen? Und was machen Sie denn noch neben Ihrem Beruf?
GO: Ich kenne Berlin gut. Ich habe schon ein Jahr hier gelebt und Zivildienst gemacht, habe Erste-Hilfe-Kurse in Schulen unterrichtet von Hohenschönhausen bis nach Dahlem. Und deswegen kannte ich Berlin immer und war auch oft in Berlin. In diesem Jahr war das erste Mal, dass ich so ein Heimatgefühl hatte. Irgendwann mal hatte ich ein langes Gespräch mit meiner Frau, und dann haben wir überlegt: Wir wussten ja, das kann viele Städte treffen. Das war auch was, was meine Kinder immer wussten, dass es noch mal weitergeht. Das haben wir immer so kommuniziert. Und in dem Gespräch mit meiner Frau kam dann tatsächlich Berlin raus.
Zu meiner Frau habe ich bei meinem Hochzeitsantrag gesagt, ich liebe dich, ich möchte mein Leben mit dir verbringen, aber ich bin oft nicht da. Ohne ihre Kinder kann sie nicht, aber ohne mich kann sie schon mal gut und das funktioniert sehr gut. Meine Frau hat auch von vornherein gesagt, dass sie sich, wenn die Kinder klein sind, um die kümmern möchte. Also ich habe da durchaus Gegenangebote gemacht, aber sie hat das ganz klar so kommuniziert. Und damit hatte ich natürlich einen ganz anderen Freiraum.
Und Hobbys: Ich lese gerne und ich freue mich jetzt auf die Dahme. Ich segle gerne und ich möchte ein Holzboot bauen.
Vorletzte Frage, wie würden Sie sich beschreiben?
GO: Ich bin integer und integrativ. Neugierig und begeisterungsfähig, und ich glaube, dass ich eine relativ offene Art habe. Irgendjemand hat mal auf meinem Geburtstag gesagt, „der Georg kommt in Himmel“.
Zu guter Letzt, wie würden Sie ein Pressestatement formulieren bzw. welche Vokabeln oder Formeln sollten darin vorkommen?
GO: Die Formeln wären Forschung, Digitalisierung und Akademisierung.
Ich würde auch das Ziel haben, weiterhin bester Arbeitgeber im Berliner Gesundheitswesen zu sein und dafür auch konkret Ressourcen einsetzen. Und so wie Prof. Ekkernkamp das ja auch schon gemacht hat, Personal oder Persönlichkeiten entwickeln, sodass sie nicht nur hier im Haus Verantwortung übernehmen, sondern auch drum herum.
» Zur Person

Prof. G. Osterhoff ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Er war zuletzt Stellvertretender Bereichsleiter der Unfallchirurgie und Geschäftsführender Oberarzt sowie Leiter des Sarkomzentrums der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie des Universitätsklinikums Leipzig.
Zu den klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkten von Prof. Osterhoff gehören zusätzlich zur Behandlung von Schwerverletzten, Becken- und Wirbelsäulenverletzungen auch die Behandlung von osteoporotischen Frakturen und die Alterstraumatologie.
Die Lehre für die Studierenden und die Nachwuchsförderung von Mediziner:innen und Wissenschaftler:innen liegen Prof. Osterhoff besonders am Herzen.
Das Interview führten Prof. Dr. med. Julia Seifert und Angela Kijewski.
Seifert J, Kijewski A: Generationenwechsel und Strukturwandel im Unfallkrankenhaus Berlin. Passion Chirurgie. 2025 September; 15(09/III): Artikel 03_04.
Autor:innen des Artikels
Weitere aktuelle Artikel
15.09.2025 BDC|News
PASSION CHIRURGIE 09/III/2025: Notfallversorgung
„Notfallversorgung“ ist das Thema der Septemberausgabe, die Sie in den nächsten Tagen auch als gedruckte Version erhalten. In dieser Ausgabe informieren wir Sie über aktuelle Entwicklungen in der Unfallchirurgie – von neuen Ansätzen in Diagnostik und Behandlung bis hin zu Themen rund um das D-Arzt-Wesen und Personalfragen.
01.09.2025 BDC|News
Editorial 09/QIII/2025: Trauma, Trauma, Trauma
Die Unfallchirurgie ist ein Fach, das eigentlich niemals stillsteht. Das gilt für den Arbeitsalltag, unsere Versorgungen, im Behandlungsergebnis meist auch für unsere Patientinnen und Patienten und letztlich auch für alles „Drum Herum“.
01.09.2025 Orthopädie/Unfallchirurgie
Sternum- und Rippenfrakturen: Wo kommen wir her? Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin?
In der heutigen Zeit ist werden schwere Thoraxtraumata für etwa 25 % der Todesfälle bei Unfallverletzten verantwortlich gemacht, etwa jeder zweite Schwerverletzte erleidet Rippen- und/oder Sternumfrakturen [1].
01.09.2025 Orthopädie/Unfallchirurgie
Die strahlenfreie Frakturdiagnostik im Kindes- und Jugendalter wird Bestandteil der Regelversorgung
Ultraschall als sichere, schnelle, strahlenfreie und gesundheitsökonomisch relevante „Point-of-Care-Diagnostik“ ist zur Diagnostik von Frakturen langer Röhrenknochen bis zum 18. Lebensjahr bereits seit August 2024 mit den gesetzlichen Unfallversicherungen besser abrechenbar als das Röntgen.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.