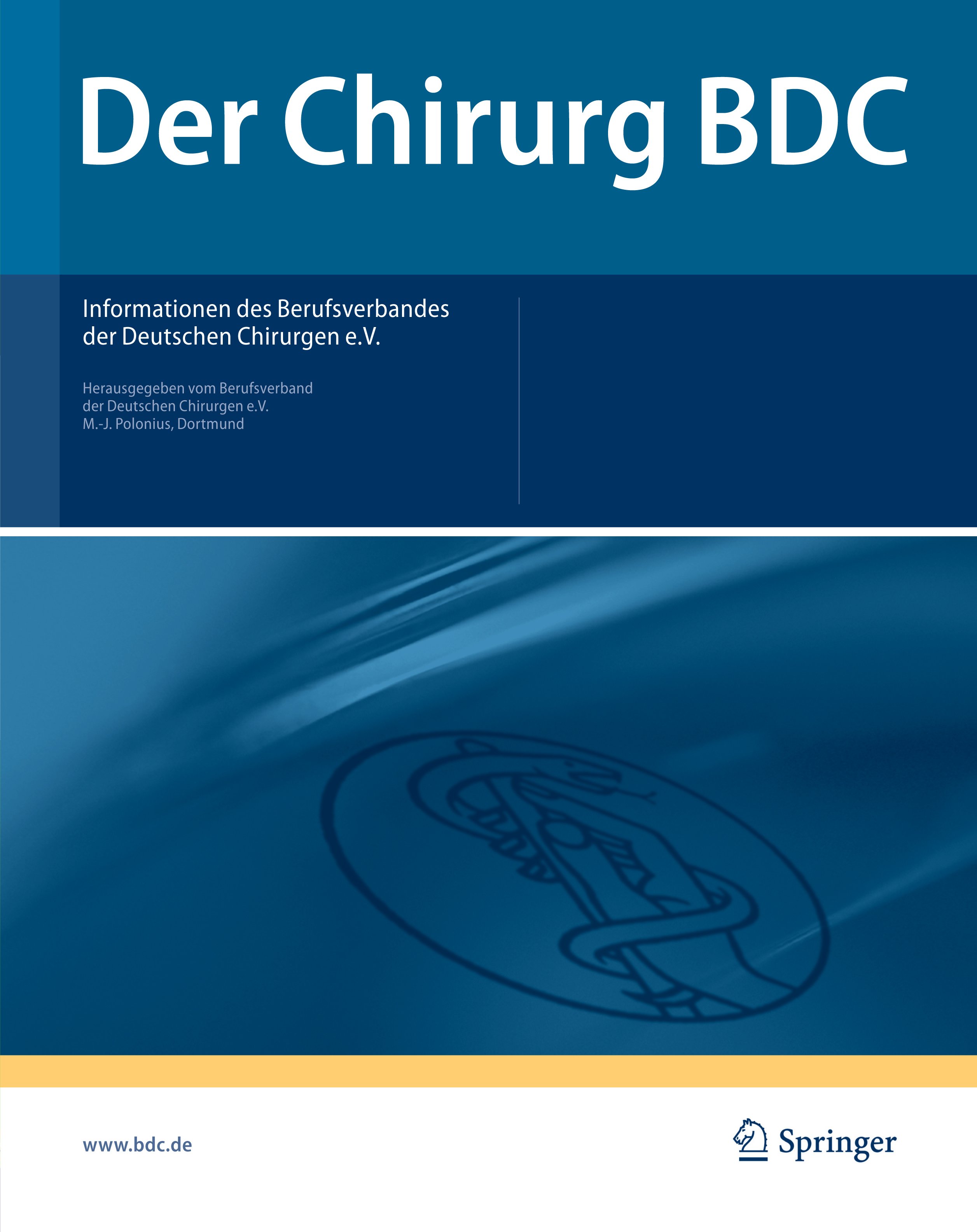01.04.2025 Politik
Der Abschied vom Bett. Wie ambulantisieren Krankenhäuser?

Im deutschen Gesundheitswesen hat sich über viele Jahrzehnte eine tripelsektorale Versorgungsstruktur gebildet. Eine Vernetzung zwischen den drei Sektoren (ambulante Versorgung, stationäre Versorgung und Rehabilitation & Pflege) ist dabei traditionell eher weniger gegeben. Zwar gibt es eine Vielzahl an Berührungspunkten zwischen den drei Sektoren und im Sinne einer patientenzentrierten Versorgung sind sektorübergreifende Versorgungsstrukturen ein Muss, jedoch sind diese notwendigen ineinandergreifenden Strukturen in Deutschland kaum ausgereift. Nicht zuletzt hat sich die Begrifflichkeit der Sektorengrenze daher in den Sprachgebrauch in Bezug auf die Patientenversorgung gefestigt.
Es ist somit nicht verwunderlich, dass Patienten und Patientinnen ihren Weg nur schwierig durch den Versorgungsdschungel, besonders über die Sektorengrenzen hinweg, finden. Die geringe Transparenz über die verschiedenen Versorgungsstrukturen macht es nicht leicht, die richtige Anlaufstelle für das spezifische Leiden zu finden. Die Ansammlung der Patienten und Patientinnen in zentralen Notaufnahmen von Krankenhäusern ist in Teilen auf die Intransparenz zurückzuführen. Sicherlich wird diese Entwicklung auch in vielen Regionen durch eine Unterversorgung mit Fach- und Hausärzten im ambulanten Bereich gefördert. Es ist zudem festzustellen, dass es auch für die in den verschiedenen Sektoren arbeitenden Beschäftigten nicht einfach ist, sich in den Strukturen sicher zu bewegen. Meist ist wenig Wissen und nur begrenztes Verständnis für die Arbeits- und Prozessweise des anderen Sektors bei den Leistungserbringern vorhanden. Eine patientenorientierte Steuerung über die Sektorengrenzen hinweg und damit die Übernahme einer Art Lotsenfunktion für Patienten:innen kann daher meist nur bedingt von den handelnden Personen erbracht werden. Wenn beispielswiese für die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen nicht nachvollziehbar ist, warum Patienten und Patientinnen nur per Einweisung in einem Krankenhaus vorstellig werden können und keine Überweisung ausgestellt wird, können Patient:innen nicht zielgerichtet in den anderen Sektor gesteuert werden.
Aber besonders trifft das Unwissen über die Inhalte und die Ausgestaltung einer umfassenden sektorübergreifenden Versorgungslandschaft auf Akteure zu, die in ihrem beruflichen Weg ausschließlich im stationären Bereich gearbeitet haben. In der Regel sind keine umfassenden Kenntnisse zu Finanzierungsstruktur, Prozessen, Leistungsspektren oder Qualifikationsvoraussetzungen der ambulanten Bereiche vorhanden. Daher werden Patienten und Patientinnen auch hier nicht wirklich zielgerichtet durch die stationären Einrichtungen und erst recht nicht zwischen den Sektoren gesteuert. Bevor jedoch genauer auf das Thema Ambulantisierung aus Krankenhaussicht geschaut wird, sollte zunächst Klarheit darüber bestehen, welche zentralen Merkmale in der Unterscheidung zwischen ambulantem und stationärem Sektor bestehen.
Der grundsätzliche Unterscheidungsfaktor zwischen dem ambulanten und stationären Sektor im Gesundheitswesen ist, dass alle medizinischen Leistungen an Patient:innen im ambulanten Bereich am selben Tag behandelt und Patient:innen auch dann wieder entlassen werden, ohne eine Über-Nacht-Leistung (Bettenleistung) zu benötigen.
Tab. 1: Übersicht der zentralen Merkmale des ambulanten bzw. stationären Sektors mit Beispielen
|
Merkmale |
Einrichtungsbeispiele |
|
|
Ambulanter Sektor |
Behandlung ohne Übernachtung |
Haus- & Facharztpraxen |
|
Flexiblere & wohnortnahe Versorgung |
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) |
|
|
Kosteneffizienter als stationäre Behandlung |
Ambulante Rehabilitation & Therapiezentren |
|
|
Stärkere Eigenverantwortung des Patienten |
Ambulante OP-Zentren |
|
|
Stationärer Sektor |
Aufnahme in eine Einrichtung mit Übernachtungspflicht |
Krankenhäuser & Universitätskliniken |
|
Intensivere medizinische Versorgung |
Rehabilitationskliniken |
|
|
24/7-Überwachung durch medizinisches Personal |
Psychiatrische Kliniken |
|
|
Höhere Kosten als im ambulanten Bereich |
||
|
Oft längere Behandlungsdauer & Nachsorge erforderlich |
Die Finanzierung der einzelnen Sektoren erfolgt über unterschiedliche Finanzierungswege und es gibt damit impliziert auch verschiedene Abrechnungsmodi, -wege und -töpfe. Aus ökonomischer Sicht ist es eher schwierig, wenn der ein oder andere Leistungserbringer seine Sektorengrenzen verlassen möchte. Ein zentraler Schritt aus den vorhandenen Schnittstellen an den Sektorengrenzen zumindest bei der Vergütung Nahtstellen zu machen, wird seitens der Politik mit dem Hybrid-DRG-Modell, welches am 01. Januar 2024 [1] in Deutschland eingeführt wurde, forciert. Seit diesem Datum gibt es für bestimmte Eingriffe und Operationen, die zuvor überwiegend stationär durchgeführt wurden, eine spezielle sektorengleiche Vergütung, die sogenannten Hybrid-DRGs. Diese Fallpauschalen werden unabhängig davon gezahlt, ob der Eingriff ambulant oder stationär erfolgt. Durch dieses Modell sollen in den kommenden Jahren ab dem Jahr 2026 jährlich mindestens eine Millionen Fälle über Hybrid-DRGs abgerechnet werden. Diese Zahl soll bis 2028 auf 1,5 Millionen und bis 2030 auf zwei Millionen Fälle ansteigen [2]. Dieses Modell zielt theoretisch darauf ab, die Ambulantisierung zu fördern und die Sektorengrenzen im Gesundheitssystem zu überwinden. Je nach Studienlage wird das ambulante Potential zwischen 15–30 % [3, 4] angegeben, was rund 2,5 Millionen Fällen entspricht. Somit schlummert aktuell noch in stationären Einrichtungen eine erhebliche Anzahl an Fällen, die aus dem Bett in den ambulanten Bereich durch beispielsweise die Hybrid-DRG wandern sollen.
Jedoch ist festzustellen, dass die meisten stationären, aber auch in Teilen die ambulanten Einrichtungen, noch gar keine entsprechenden Versorgungsstrukturen haben, um effizient in der Welt der Hybrid-DRGs agieren zu können. Die Finanzierung in den ambulanten Strukturen setzen eine hohe Effizienz und Effektivität der Prozesse voraus. In stationären Einrichtungen sind Prozesse meist vom Gegenteil geprägt. Für stationäre Einrichtungen ist es daher besonders herausfordernd ihre Prozesse auf den mit den Hybrid-DRGs verbundenen Ambulantisierungsweg auszurichten. Es bedarf nicht nur dem Kow-how wie in einem auf stationäre Leistungen ausgerichteten Setting ambulante Strukturen wirtschaftlich parallel existieren können, sondern alle in den Primärprozess involvierte Berufsgruppen (speziell: Ärztinnen/Ärzte, Pflege, Funktionsmitarbeiter:innen und medizinische Fachangestellte) müssen sich maximal sicher zwischen diesen beiden „Welten“ bewegen können. Dafür bedarf es zum einen unterstützende Prozessstrukturen in den stationären Einrichtungen. Jedoch viel wichtiger ist es, dass die Beteiligten an der Leistungserbringung so früh wie möglich im Patientenversorgungsprozess erkennen, in welches Versorgungssetting (ambulantes oder stationäres Setting) der Patient/die Patientin eingeschleust werden muss. Bereits beim Erstkontakt der Patient:innen mit der stationären Einrichtung ist die korrekte Weiche zu stellen, um den Patient:innen in die richtige Sprechstunde in einer Klinik zu lotsen oder in den ambulanten Bereich zu lenken. Diese Voraussetzung ist in vielen Krankenhäusern noch nicht gegeben. Das Hybrid-DRG-Modell ist jedoch nur eines der angedachten Anreizsysteme, um die bettengebundene Versorgung in stationären Einrichtungen deutlich zu reduzieren. Im Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) sind weitere Maßnahmen definiert.
Die aktuellen rechtlichen Entwicklungen durch das KHVVG haben einen fundamental eingreifenden, strukturellen Veränderungscharakter und flankieren die Ambulantisierungsbestrebungen der Politik massiv. Mit der Inkraftsetzung zum 12. Dezember 2024 des KHVVG, sind zentrale Regelungen zur Ambulantisierung konkretisiert worden [5].
Zentrale Regelungen zur Ambulantisierung im KHVVG lassen sich auf fünf Punkte zusammenführen:
- Hybrid-DRGs: Einführung bundeseinheitlicher pauschaler Vergütungen für ambulante Eingriffe. Diese „Hybrid-DRGs“ orientieren sich an den bisherigen stationären DRG-Fallpauschalen, sind aber für ambulante Leistungen angepasst. Dadurch sollen Anreize geschaffen werden, planbare Eingriffe nicht mehr stationär durchzuführen.
- Erweiterung des AOP-Katalogs: Der Ambulante Operieren-Katalog (AOP-Katalog) wird weiter ausgebaut. Mehr Behandlungen sollen ambulant abrechenbar sein, sodass Kliniken sie nicht mehr stationär durchführen.
- Erleichterung der sektorenübergreifenden Versorgung: Stärkere Vernetzung zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Aufbau von integrierten Versorgungsmodellen zur ambulanten Nachsorge. Förderung von Tageskliniken für bestimmte Behandlungen sowie von pädiatrischen Institutsambulanzen.
- Finanzielle Anreize zur Ambulantisierung: Neue Vergütungsmodelle für ambulante Leistungen sollen wirtschaftlich attraktiv für Krankenhäuser sein. Anpassung der Krankenhausfinanzierung, um stationäre Fehlanreize zu vermeiden.
- Bürokratieabbau & schnellere Umsetzung: Reduzierung bürokratischer Hürden für ambulante Behandlungen. Krankenhäuser erhalten mehr Flexibilität bei der Umstellung auf ambulante Strukturen.
Ein zentrales Ziel des KHVVG ist also, mehr Patientinnen und Patienten ambulant zu versorgen, wenn eine stationäre Behandlung nicht zwingend erforderlich ist. Dadurch sollen Krankenhäuser entlastet und gleichzeitig die Kosten im Gesundheitssystem gesenkt werden. Ein weiteres Ziel des KHVVG ist es, Krankenhausleistungen stärker in den ambulanten Bereich zu verlagern, um die Effizienz im Gesundheitswesen zu steigern. Etwas provokativ formuliert, könnte das KHVVG als eine Gesetzgebung verstanden werden, die eine verordnete Verabschiedung vom Bett ist. Ein größerer Anteil des aktuell noch stationären Geschäfts wird zukünftig in anderen Strukturen stattfinden müssen, um wirtschaftlich als stationäre Einrichtung einigermaßen bestehen zu können.
Dies impliziert, dass Krankenhäuser in einer deutlich höheren Geschwindigkeit als in der Vergangenheit sich in ambulante Strukturen entwickeln und flankierend ein belastbares Netzwerk mit dem ambulanten Bereich auf- und ausbauen müssen.
Zentrale Maßnahmen aus Sicht der Krankenhäuser, um diesen Wandel erfolgreich zu gestalten, sind insbesondere folgende:
1. Strukturelle Anpassungen
- Auf- oder Ausbau von Ambulanten Zentren (z. B. MVZ, Tageskliniken)
- Einrichtung von Kurzliegerstationen für Patient:innen mit kurzen stationären Aufenthalten („Hybridstationen“)
- Anpassung von OP-Kapazitäten für mehr ambulante Eingriffe und/oder Auslagerung dieser Fälle in ein ambulantes OP-Zentrum
- Optimierung der Bettenplanung – weniger klassische Betten, mehr flexible Tagesstrukturen
- Netzwerk zwischen ambulanten und stationären Bereichen auf- und ausbauen (Einweiserbeirat, regelhafte Einweiserveranstaltungen, gemeinsame Stammtische und Qualitätszirkel)
- Gezielter Aufbau und Nutzung von ambulanten Versorgungsmöglichkeiten (Hochschulambulanzen, ambulante spezialfachärztliche Versorgung (ASV), Sozialpädiatrische Zentren (SPZ), Institutsambulanzen, Tagesstationäre Behandlungen, KV-Ermächtigungen etc.)
- Verzahnte ambulante und stationäre Versorgungsstrategie für ein Krankenhaus (keine isolierte Strategieentwicklung mehr)
2. Medizinische & Prozessuale Veränderungen
- Erweiterung ambulanter OP-Kapazitäten
- Bessere Patientensteuerung und Entlassmanagement, um schnelle Nachsorge zu ermöglichen
- Etablierung digitaler Nachsorgeangebote (Telemedizin, Videosprechstunden)
- Kooperationen mit niedergelassenen Ärzten zur besseren Verzahnung
3. Abrechnung & Finanzierung
- Nutzung von Hybrid-DRGs zur besseren Vergütung ambulanter Leistungen
- Entwicklung neuer Versorgungsverträge zur Sicherstellung ambulanter Erlöse
4. Personal & Qualifikation
- Schulung von Ärzten und Pflegepersonal für ambulante Eingriffe und Prozesse
- Ausbildung des ärztlichen und pflegerischen Personals sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich
- Alternative Arbeitsmodelle für das Personal schaffen, z. B. durch sektorübergreifende Anstellungsverhältnisse
- Nach Möglichkeit Aufnahme einer betrieblich verantwortlichen Stelle in die Organigramm-Struktur für den ambulanten Bereich
5. Digitalisierung & Technikeinsatz
- Einsatz von KI und digitalen Tools zur besseren Patientendokumentation
- Digitale Termin- und Ressourcenplanung für effizientere Abläufe
- Telemonitoring und Homecare-Lösungen zur Verlagerung von Leistungen in den häuslichen Bereich
- Digitale Austauschplattformen zur Befundübermittlung etc. zwischen stationären und ambulanten Leistungserbringern schaffen
Fazit
Krankenhäuser müssen sich strukturell, personell und finanziell auf die Ambulantisierung einstellen. Durch flexible Versorgungsstrukturen, digitale Unterstützung, gemeinsame Ausbildungsmöglichkeiten, Wissenstransfer und enge Kooperationen mit dem ambulanten Sektor können sie sich zukunftssicher aufstellen.
Die Literaturliste erhalten Sie auf Anfrage via passion_chirurgie@bdc.de.

ppa. Tanja Engel
Geschäftsbereichsleitung Stationäre Versorgung
St. Vincenz-Kliniken
Am Busdorf 2
33098 Paderborn
Chirurgie
Engel T: Der Abschied vom Bett. Wie ambulantisieren Krankenhäuser? Passion Chirurgie. 2025 April; 15(04): Artikel 03_01.
Mehr über die Krankenhausreform auf BDC|Online (www.bdc.de) unter der Rubrik Politik.
Weitere aktuelle Artikel
07.03.2023 Politik
Elektronische Patientenakte ab Ende 2024 laut Lauterbach „für alle verbindlich“
"Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern wichtiger Bestandteil moderner Medizin"
07.03.2023 Politik
Aktuelle Stellungnahme „Bereitstellung und Nutzung von Behandlungsdaten zu Forschungszwecken“
Die Ethikkommission bei der Bundesärztekammer veröffentlicht aktuell ihre Stellungnahme zu Behandlungsdaten.
06.03.2023 Politik
KBV: Gassen als Vorsitzender bestätigt
An der Spitze der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) steht weiter Dr.
03.03.2023 Politik
Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege gibt Gutachten 2023 heraus
Der SVR-Gesundheit urteilt über das deutsche Gesundheitssystem, für Krisen weiterhin nicht gut gewappnet zu sein.
Lesen Sie PASSION CHIRURGIE!
Die Monatsausgaben der Mitgliederzeitschrift können Sie als eMagazin online lesen.